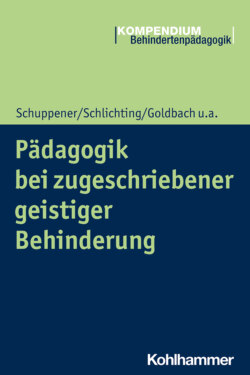Читать книгу Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung - Anne Goldbach - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dekategorisierung
ОглавлениеDie von Buschlinger (2000) und Feuser (2000) oben erwähnte Problematik der Semantik ›geistig/Geist‹ in der Begrifflichkeit Geistige Behinderung wird gemeinhin im deutschen Sprachraum anerkannt ( Kap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von ›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denken mit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr. Er ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Nennt man einen Menschen in seinem Geist behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld 2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekategorisierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schulischen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.
Im allgemeinen Fachdiskurs lassen sich jedoch immer wieder auch Tendenzen von Dekonstruktionen und Dekategorisierungen ausmachen, die auf der radikalen und alternativlosen Abschaffung des Begriffes ›geistig behindert‹ und einem Verzicht auf diese Form der Zuschreibung basieren, weil damit eine Dehumanisierung und Anonymisierung einhergeht (vgl. Feuser 2016). Derartige Dekategorisierungsforderungen wurden u. a. schon von Kobi (2000) und Gaedt (2003) als risikoreich beschrieben, weil sie eine »Akzeptanz der Differenz« (Kobi 2000, 77) verhindern würden in Form von »Verklärungen«, »Positivierungen« oder Versuchen begrifflicher »Auflösungen« (ebd., 73 ff.). Mit Bezugnahme auf das Konstrukt der egalitären Differenz (vgl. Prengel 2001) bleibt hier zu bestätigen, dass Differenz eine grundlegende Kategorie und Voraussetzung für Erkennung und Anerkennung darstellt und eine Leugnung von Differenz die Gefahr der Ausblendung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und deren Konsequenzen impliziert.
Wir teilen die Auffassung, dass es unmöglich ist, nicht zu kategorisieren26: »Ein gänzlich kategorienabstinentes Denken entzieht sich den menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten« (Boger 2018, o. S. mit Bezug auf Levold & Lieb 2017). Damit geht es vielleicht in einem pragmatischen Sinne weniger um das Bestreben nach Dekategorisierung im Sinne eines Verzichts auf Kategorien (vgl. Walgenbach 2018), sondern vielmehr um die Kontextualisierung von Begrifflichkeiten und die Reflexion der (Re)Produktionsmechanismen damit einhergehender Kategorien. Es geht also (auch) um die Frage nach der Entstehungsperspektive: Wem nützt wann welche Orientierung an einer Norm (vgl. Boger 2018)? Wer identifiziert sich in welchem Kontext mit welcher kategorialen Zuschreibung und warum tut sie/er das? Boger verweist in diesem Zusammenhang auf die doppelte Erschließungsnotwendigkeit nicht nur der sozialen Normalitätsraster als Grundlage für Kategorisierungen, sondern auch der »Selbstnormalisierungen und Selbstpathologisierungen, die vom Subjekt selbst ausgehen« (ebd.).
Exkurs: Mit Blick auf den grundlegenden Dekategorisierungsdiskurs in der (Sonder)Pädagogik möchten wir darauf verweisen, dass die Bedeutung von Kategorien in der Regel als unverzichtbar im Rahmen eines professionellen pädagogischen Handlungskonzeptes verstanden werden kann (vgl. Georgi & Mecheril 2018). Georgi und Mecheril (2018) weisen zu Recht darauf hin, dass einem kategorienbezogenen Wissen nicht nur »ein einschränkender, festlegender und auch gewaltförmiger Zug inne« (65) wohnt, sondern Kategorien zunächst als »professionelle Deutungs- und Wahrnehmungsroutinen« zu verstehen sind, welche als »aufeinander in einem Ordnungssystem verwiesene Begriffe zur Strukturierung und Herstellung von Erkenntnis« (ebd.) beitragen. Die Autorinnen berufen sich hier u. a. auf Hornscheidt (2007) in der Lesart, Kategorien als ein »strukturierendes Moment von Wissen« (73) anzuerkennen, welches so gesehen dann das eigene pädagogisch-professionelle Handeln legitimiert. Gleichzeitig ist mit dieser Legitimation auch die Verpflichtung verbunden, die Wirkungen und Folgen des Handelns zu erklären und zu verantworten (vgl. Georgi & Mecheril 2018), und hier schließt sich unseres Erachtens die Dimension an, die wir hier im Kontext einer verbesondernden Pädagogik aufrufen: die Reflexion der Entfaltung von struktureller Diskriminierung durch sprachliche Konstruktionen.
Vor dem Hintergrund dieses Reflexionsanspruches vermischen sich Rekategorisierungs- und Dekategorisierungsforderungen, weil es beiden Ansprüchen weniger um eine »sprachphilosophische Revolte« als vielmehr um »eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf pädagogisch bedeutsame Kategorien« (Walgenbach 2018, 12; Hervorhebung d. A.) geht. Stark an den Anspruch der Dekategorisierung geknüpft scheint der Verzicht auf »separierende bzw. personenbezogene Organisationsmodi in Bildungsinstitutionen« (ebd.), während sich eine Rekategorisierung hier nicht zwingend mit einem Verzicht, sondern eher mit einer tiefgreifenden Reflexion entsprechender kategorialer Zuschreibungen und deren Konsequenzen assoziieren lässt.
Und genau diese Reflexion – auch im Sinne einer maximalen Flexibilisierung kategorialen Denkens und Sprechens – ist aus unserer Sicht zentral. Dafür gilt es, Kategorien keine absolute Wirkmacht zu gewähren, denn:
»Es ist der Absolutheitsglaube, der aus Kategorien Käfige macht. Also die vermessene Vorstellung, die eigene, begrenzte, limitierte Perspektive auf die Welt sei komplett, vollständig, universal. Der Hochmut, zu glauben, einen anderen Menschen in seiner ganzen Komplexität abschließend verstehen zu können. Oder gar eine ganze konstruierte Kategorie von Menschen abschließend verstanden zu haben« (Gümüşay 2020, 134; Hervorhebungen i.O.)27.
Für das Selbstverständnis der Disziplin einer Pädagogik der Verbesonderung stellt sich im Kontext der Dekategorisierung die daraus resultierende Frage nach »ihrem Gegenstand« (vgl. Musenberg & Riegert 2013; Hervorhebung d. A.): Orientiert man sich nicht über eine kategorial hervorgebrachte Personengruppe, bliebe alternativ lediglich eine Orientierung über institutionelle Zuständigkeitsbereiche innerhalb der Profession. Eine entsprechende ausschließliche Ausrichtung der disziplinären Legitimation über die Existenz von Sondereinrichtungen (Sonderschulen und Einrichtungen der so genannten Behindertenhilfe) offenbart jedoch riskante und unerwünschte Perspektiven. Es bleibt demzufolge auch auf der Ebene der Profession die Frage:
»Wenn eine Orientierung am Begriff der geistigen Behinderung und eines entsprechenden Personenkreises empirisch wie normativ kein gangbarer Weg mehr ist oder sein soll […], an welche Situationen und Prozesse die bisherige Geistigbehindertenpädagogik gebunden werden könnte, wenn sie sich nicht über die spezifische Klientel legitimieren will‹ (Hinz & Boban 2008, 210)« (Musenberg & Riegert 2013, 161)?
Fasst man den kurzen, fragmentarischen Einblick in Begrifflichkeitsdiskurse zusammen, bleibt zu bilanzieren, dass der Terminus ›Geistige Behinderung‹ von den Personen, die so bezeichnet werden, durchgehend abgelehnt wird! Das allein sollte prinzipiell dazu verpflichten, den Terminus nicht mehr zu verwenden, und fordert die Diskussion und Nutzung einer begrifflichen Alternative28 oder eine radikale Auflösung dieser Zuschreibung. Es wird jedoch von keinem der oben erwähnten Autorinnen* ohne Behinderungserfahrungen ein alternativer Terminus mit ›Lösungs- oder Verbesserungscharakter‹ vorgeschlagen, wenngleich der Begriff der ›Geistigen Behinderung‹ – wie dargelegt – vielerorts als kritikwürdig markiert ist.
Dem müssen wir uns – in selbstkritischer Form – anschließen und in Ermangelung einer geeigneten begrifflichen Alternative, die auf breite Zustimmung stößt29, möchten wir in unseren Ausführungen den Begriff der ›Geistigen Behinderung‹ zwar verwenden, jedoch zumindest versuchen, dies konsequent in einer kritisch-reflektierten und distanzierten Form zu tun:
Auch wenn der Vorschlag Sie/euch als Leserinnen* herausfordert, möchten wir von einer substantivierten Begriffsfassung gänzlich absehen – um kategoriale Festschreibungen zu vermeiden – und weder von ›Geistig Behinderten‹, noch von ›Menschen/Personen mit geistiger Behinderung‹ sprechen, sondern primär von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet/ adressiert/konnotiert/attribuiert/beschrieben/wahrgenommen werden, oder von Menschen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben/zugewiesen/auferlegt wird oder von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Das markiert unserer Ansicht nach zumindest eine Distanzierung von einer Personifizierung und der Unterstellung, dass eine Diagnose als zentrales Identitätsmerkmal anerkannt werden könne. Es versucht zu verdeutlichen, dass es sich um eine (diagnostische) Zuschreibungssituation von Individuen handelt, mit denen – aus der Subjektperspektive betrachtet – allenfalls eine situationsbezogene Identifikation erfolgen kann; z. B. in der Form, dass ein Bewusstsein dafür besteht, in bestimmten Kontexten in unserer Gesellschaft als geistig behindert wahrgenommen oder bezeichnet zu werden.
Wir finden es dennoch wichtig zu markieren, dass bei dieser Art der Zuschreibung immer die große Gefahr der Internalisierung und Übernahme dieses diagnostischen Attributes im Sinne einer ›self-fulfilling prophecy‹ oder einer Pathologisierung in der eigenen Selbstwahrnehmung und Selbstbeschreibung besteht. Da wir hier in dieser Publikation zwangsläufig über einen Personenkreis schreiben, der mit diesem Diagnose-Etikett lebt, besteht unser Minimalanspruch darin, die Dimension der Zuschreibung von außen und die Relativität zu verdeutlichen und zu betonen. Dabei geht es weder um eine Leugnung der Existenz von Menschen, die mit diesem Etikett und allen damit verbundenen Konsequenzen leben – im Gegenteil: Es geht eher um einen Beitrag zu einer stärkeren Sichtbarkeit dieser benachteiligten Personen im gesellschaftspolitischen Diskurs –, noch um sprachliche Verrenkungen (vgl. Feuser 2016) mit dem Wunsch nach einer ›Absolution von Diskriminierung und Diskreditierung‹. Es geht auch nicht um ein Verstecken hinter einer weniger negativ klingenden Begrifflichkeit oder das Aberkennen vorhandener Vulnerabilitäten und Leidenssituationen der betreffenden Personen. Es geht uns um einen offenen Umgang mit dem eingangs erwähnten Dilemma der Unauflösbarkeit, welches wir hiermit zwangsläufig fortschreiben. Wenngleich wir keinen Alternativbegriff und keine alternativen Kategorisierungen vorschlagen/verwenden, möchten wir uns in diesem Buch dennoch grundsätzlich für eine Position der Rekategorisierung aussprechen: Die konsequente relationale Verortung und Verwendung des Begriffes ›Geistige Behinderung‹ ist kein Lösungsvorschlag; vielmehr ist sie Ausdruck einer Tast- und Suchbewegung und eines mahnenden Erinnerns an damit verbundene Stigmatisierungen sowie ein trauriger Tribut an die kritikwürdige Realität der Existenz und (inflationären) Verwendung des Begriffes ›Geistige Behinderung‹ in vielen gesellschaftlichen Wirkungsfeldern (Alltagsrecht, Politik, schulische Kontexte, Alltagsverständnis, diagnostische Kontexte etc.).
Wir bewegen uns also in einem offen bekundeten Widerspruchsfeld, indem wir nach wie vor Kategorien sprachbezogen aufrufen und bedienen, jedoch gleichzeitig die allumfassende Kritikwürdigkeit selbiger markieren. Hier bleibt zu bilanzieren, dass genau darin auch ein Kernmerkmal einer Pädagogik der Verbesonderung liegen kann:
»Der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, sich auf kategorial gefasstes Wissen professionell zu berufen und der Notwendigkeit, sich von kategorial gefasstem Wissen zu distanzieren, ist insofern dieser aus der Struktur des Handlungsfelds resultiert konstitutiv für (schul-)pädagogische Professionalität« (Georgi & Mecheril 2018, 67).
Wir möchten demnach dem formulierten Anspruch von Georgi und Mecheril folgen und zumindest zu einer transparenten Reflexion dieser Widersprüche als einem Professionalisierungsanliegen einladen.