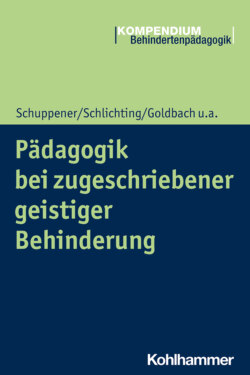Читать книгу Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung - Anne Goldbach - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Entwicklungen in der DDR
ОглавлениеNach dem Zweiten Weltkrieg war die Hilfsschule auf dem Gebiet der ehemaligen DDR formal dem allgemeinen System der Schulen zugeordnet. Dies wurde im Schulgesetz von 1945 bestimmt. In seinen Ausführungsbestimmungen wurde für sogenannte bildungsfähige, körperlich oder geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche die Schulpflicht festgeschrieben (vgl. Werner 1999 in Barsch 2007, 21).
In den 1950er Jahren wurden Kinder, die die Kulturtechniken nicht erlernen konnten, zunehmend aus den Hilfsschulen ausgegliedert. Für diese Kinder prägte sich der Begriff der ›Schulbildungsunfähigkeit‹, was 1969 in den »Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem« bestätigt wurde und zur kompletten Ausschulung dieser Schülerschaft führte (vgl. ebd.). Der Besuch der Hilfsschule war demzufolge nur für die sogenannten schulbildungsfähigen Intelligenzgeschädigten, die sich elementare Fähigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens aneignen konnten, vorgesehen (vgl. ebd.). Die als schulbildungsunfähig und förderungsfähig bezeichneten Kinder besuchten auf der Grundlage der »Programmatischen Empfehlungen des Ausschusses für Gesundheitswesen der DDR« 1968/1969 die rehabilitationspädagogischen Förderungseinrichtungen, die dem Gesundheits- und Sozialsystem unterstellt waren (vgl. ebd.). 1973 entstand an der Humboldt-Universität in Berlin der erste »Entwurf eines Rahmenplanes zur Förderung schulisch nicht mehr bildbarer, aber noch förderungsfähiger hirngeschädigter Kinder und Jugendlicher in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens«. Damit wurde erstmals in der DDR eine pädagogische und methodische Richtlinie für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sogenannter Intelligenzschädigung veröffentlicht (vgl. ebd.).
Kinder und Jugendliche, die rehabilitationspädagogisch nicht mehr erfolgreich zu fördern waren, galten als ›schulbildungs- und förderungsunfähig‹. Für sie gab es neben der Betreuung und Versorgung im Elternhaus nur die Unterbringung in den entsprechenden Abteilungen der psychiatrischen Großkliniken oder in kirchlichen Heimen. Auch die Rehabilitationspädagogik als Disziplin wandte sich diesen Kindern und Jugendlichen nicht zu (vgl. ebd.). Sie galten als ›Pflegefälle‹ und waren nach damaliger Meinung pädagogischen Bemühungen nicht zugänglich.
Ab Mitte der 1950er Jahre wurden in der DDR Beratungsstellen des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes aufgebaut, die den Räten der Städte und Gemeinden unterstellt waren. Mit Vollendung des 3. Lebensjahres und vor Schuleintritt wurden alle Kinder nach einem verbindlichen Untersuchungsprogramm bezüglich ihrer Schulfähigkeit beurteilt (vgl. ebd.). Bei der Feststellung einer ›Intelligenzschädigung‹ wurde das Kind je nach Schweregrad für die Hilfsschule, für eine Förderungstagesstätte oder als ›Pflegefall‹ für ein Dauerheim oder eine psychiatrische Anstalt vorgeschlagen. Eine Versorgung in der Familie war prinzipiell möglich, wurde aber entsprechend der generellen Institutionalisierung der Kinderbetreuung in der DDR nicht gerne gesehen. Familien, die ihr Kind zu Hause betreuen wollten, erhielten ein geringes Sonderpflegegeld von 200 Mark der DDR (vgl. ebd.).
Positiv beeinflusst durch die sozialistische Ideologie, welche der Arbeit einen zentralen Stellenwert zusprach, kam es in den 1970er Jahren zur Entwicklung sogenannter geschützter Arbeit. Diese konnte in verschiedenen Formen stattfinden. So gab es die ›geschützten Werkstätten‹ des Gesundheits- und Sozialwesens, ›geschützte Betriebsabteilungen‹, ›geschützte Einzelarbeitsplätze‹ und Heimarbeit. In der »Anordnung [Nr. 1] zur Sicherung des Rechts auf Arbeit für Rehabilitanden« in der Novellierung 1976 wurden Betriebe und Einrichtungen sowie staatliche Organe zur Schaffung von Arbeitsplätzen für ›schwer- und schwerstgeschädigte Bürger‹ aufgefordert. Diese Verpflichtung wurde 1977 im Arbeitsgesetzbuch festgeschrieben (vgl. ebd.). Allerdings gab es keine flächendeckende Arbeitsvergabe. Insbesondere ›intelligenzgeschädigte Menschen‹ in Anstalten waren davon ausgeschlossen.
Die Betreuung von Menschen, die als ›Pflegefälle‹ und damit als nicht bildungs- und förderungsfähig galten, war in der DDR bis zur Wende und auch noch in den Jahren danach sehr unbefriedigend. Für die Unterbringung und Betreuung dieser Personengruppe gab es nur marginale Rechtsvorschriften (vgl. ebd.). Die meisten von ihnen lebten in den Einrichtungen der Psychiatrie. Psychiatrische Versorgung bedeutete in der DDR die Verwahrung in baufälligen Großkliniken mit desaströser sächlicher Ausstattung und einem großen Mangel an Ärztinnen* und Pflegekräften. Zwischen 35 bis 70 % der ›Patientinnen*‹ war ›fehlplatziert‹ und nicht behandlungsbedürftig, wie beispielsweise chronisch Kranke und Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung (vgl. Klee 1993). Die Verweildauer in psychiatrischen Krankenhäusern betrug bei einem Viertel der Menschen mehr als 10 Jahre (vgl. Bach 1992). Die DDR-Psychiatrie war zentralistisch organisiert, biologistisch ausgerichtet und durch die konsequente Übernahme des naturwissenschaftlichen Krankheits- und Therapieverständnisses gekennzeichnet. In der praktischen Umsetzung waren damit die Anwendung von Elektroschocks, Fixierungsmaßnahmen und die Gabe von hohen Dosen an Psychopharmaka verbunden. Sozialpsychiatrische Handlungskonzepte und Fördermaßnahmen spielten keine Rolle (vgl. Klee 1993). Weiterhin boten die psychiatrischen Anstalten ein menschenunwürdiges Bild mit großen Schlafsälen, karger, ärmlicher Möblierung, die nichts Individuelles zuließ und keinerlei Privatsphäre zuerkannte sowie offenen Waschräumen und Toiletten als Gipfel der Entwürdigung und Entmenschlichung (vgl. ebd.).
In der »Verordnung über Feierabend- und Pflegeheime« von 1978 formulierte das Gesundheitsministerium die Zuständigkeiten für erwachsene Menschen mit einer psychischen Schädigung (vgl. Barsch 2007). Hier sollten Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihres gesundheitlichen und körperlichen Zustandes eine Betreuung und Pflege benötigen, aufgenommen werden. Für sogenannte psychisch geschädigte Bürgerinnen* – damit waren auch Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung gemeint –, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten, waren demzufolge Pflegeheime bzw. Stationen in den psychiatrischen Anstalten für Erwachsene vorgesehen (vgl. ebd.).
Vergleicht man die Entwicklungen der beiden deutschen Staaten miteinander, so ist festzustellen, dass während der ersten 10 Jahre nach deren Gründung die Gemeinsamkeiten überwiegen. Allerdings zeigt sich in den 1970er Jahren in der BRD ein tiefgreifender Veränderungsprozess, der mit einer Abkehr vom medizinischen Verständnis von Behinderung, der Einführung der Schulpflicht für Kinder mit zugeschriebener geistiger Behinderung sowie der beginnenden Diskussion um Integration und Normalisierung einherging (vgl. Fornefeld 2013; Ellger-Rüttgardt 2008). Das Stagnieren der Entwicklung in der DDR führt Barsch auf die geringen Ressourcen zum Aufbau eines Bildungs- und Betreuungswesens und die systembedingte Verhinderung der Bildung von Elternverbänden und Interessenvertreterinnen* zurück, die sich für die Belange von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung einsetzten (vgl. Barsch 2007). Bis zur Wende blieb der medizinisch-psychiatrische Blick auf Behinderung bestehen, und das gesamte Betreuungssystem für den Personenkreis oblag dem Gesundheitswesen. Während des Bestehens der DDR wurde eine sogenannte geistige Behinderung ausschließlich medizinisch erklärt und auf organische Ursachen zurückgeführt. Eine Entwicklungsverzögerung aufgrund sozialer bzw. milieubedingter Ursache passte nicht zur herrschenden Ideologie und wurde für ›unmöglich‹ erklärt. Das positive Wirken der sozialistischen Gesellschaft sollte ja gerade dies grundlegend verhindern (vgl. ebd.).