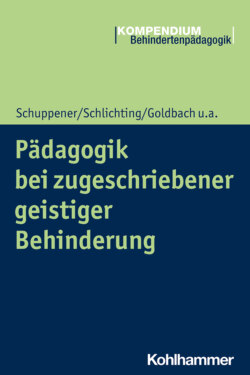Читать книгу Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung - Anne Goldbach - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Entwicklung einer sogenannten Geistigbehindertenpädagogik Entwicklung in der BRD
ОглавлениеAnalog zur bundesdeutschen Sozialpolitik knüpfte auch die Bildungspolitik an die Gesetzgebung der Weimarer Republik und die Gesetze des völkischen Führerstaates an. Der Wiederaufbau des Hilfsschulwesens wurde Ende der 1940er Jahre von der Initiative der Hilfsschullehrerinnen* getragen. 1949 gründete sich bereits der Verband der deutschen Hilfsschulen (VDH)32. An einem Einbezug von sogenannten ›Schwerschwachsinnigen‹ und ›Bildungsunfähigen‹ bestand allerdings kein Interesse. Anknüpfend an die traditionellen Denkmodelle unterschied der VDH zwischen hilfsschulbedürftigen Kindern und Kindern, die Anstaltspflege benötigen (vgl. Thümmel 2003). Die noch existierenden kirchlichen Anstalten standen nach dem Ende des NS-Regimes vor großen finanziellen und personellen Problemen. So bildeten in der Nachkriegszeit oft die psychiatrischen Anstalten den einzigen außerfamiliären Lebensort für sogenannte ›schwachsinnige‹ Menschen. Für die als ›bildungsunfähig‹ angesehenen Kinder und Jugendlichen war keine schulische Bildung vorgesehen, pädagogische Hilfen beschränkten sich auf einzelne mehr oder weniger private Initiativen. Diese umfassten hortähnliche Einrichtungen, Sammelklassen oder sog. Tagesheimschulen (vgl. Speck 1979).
Der Wendepunkt wurde sichtbar, als Eltern, unterstützt von einigen wenigen Fachleuten, die Initiative ergriffen und sich für das Recht auf Erziehung und Bildung für ihre Kinder einsetzten. Als zentrale Organisationsfigur fungierte hierbei der holländische Sozialpädagoge Tom Mutters. Dieser übernahm als Verbindungsoffizier der Vereinten Nationen im Phillips Hospital Goddelau die Betreuung von Flüchtlingskindern, die als geistig behindert galten. Tom Mutters, der an die Entwicklung dieser Kinder glaubte, organisierte in der ganzen Welt Spenden und informierte sich über Möglichkeiten der Förderung im Ausland. Kontakte zwischen ihm und den Eltern führten zur Bildung eines bundesweiten Netzwerkes, das im Ergebnis zur Gründung der »Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind« 1958 in Marburg führte. Unter dem Dach der Bundesvereinigung kam es zur Bildung von örtlichen Regionalgruppen. Hier entstanden die ersten Fachgremien wie der Sozialbeirat, der wissenschaftliche Beirat, der pädagogische Ausschuss und der Werkstattausschuss (Thümmel 2003). Gleichzeitig plädierte Otto Speck 1958 für eine Revision der sonderpädagogischen Terminologie ›bildungsunfähig‹; dieser sei »historisch schwer belastet« und »mit viel Unrecht und Unheil« (Ellger-Rüttgart 2008, 304) verknüpft.
Als großes Ziel formulierte die Lebenshilfe, Bildungsmöglichkeiten für diese Kinder aufzutun. 1960 veröffentlichte die Lebenshilfe eine Denkschrift über die Bildbarkeit ›geistig behinderter Menschen‹, welche in erster Linie dazu diente, die Schulbehörden auf einen Rechtsanspruch auf Bildung für diese Personengruppe aufmerksam zu machen. Sie forderten eine eigenständige Schulform für ihre Kinder. Erste Schritte auf dem Weg zur Durchsetzung staatlicher Schulen bildete die Einrichtung von Tagesbildungsstätten (vgl. Thümmel 2003).
Von 1965 bis 1968 erarbeitete Heinz Bach Empfehlungen »Zur Ordnung von Erziehung und Unterricht an Sonderschulen für Geistigbehinderte« (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1966 in ebd.). Diese Empfehlungen bildeten für viele Schulen, die sich ab den 1960er Jahren gründeten, die konzeptionelle Grundlage. Es wurden allerdings wiederum Mindestvoraussetzungen formuliert. Dazu gehörten Hand- und Fortbewegungsfähigkeit, Sprachverständnis, Gruppenfähigkeit, Sauberkeit und die Fähigkeit, sich auf Tätigkeiten kurzfristig zu konzentrieren. Für sogenannte Pflegefälle sollte die Schulpflicht ruhen (vgl. ebd.).
Mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) von 1961 wurde das Recht auf Sozial- und Eingliederungshilfe neben anderen Personengruppen auch für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung festgeschrieben (vgl. ebd.). Dieses schaffte die Grundlage für den Aufbau eines für die damalige Zeit fortschrittlichen Versorgungssystems mit Frühfördereinrichtungen, Werkstätten (später Werkstätten für Behinderte, WfB) und Wohnheimen. Die Lebenshilfe war bei der Gründung vieler dieser Institutionen eine wesentliche Triebkraft.
Die 1972 von der Kultusministerkonferenz veröffentlichte »Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens« definierte wie schon 1960 die Sonderschule als »eigenständige Schulform«, die durch zehn verschiedene Sonderschularten repräsentiert wurde. Neben der Schule für ›Lernbehinderte‹, ›Körperbehinderte‹ usw. gehörte hier die Schule für ›Geistigbehinderte‹ dazu (vgl. Ellger-Rüttgart 2008). In dieser Empfehlung wurde erstmals der für die damalige Situation fortschrittliche Gedanke eines präventiven Charakters sonderpädagogischen Bemühens betont und es als erstrebenswert formuliert, den Anteil der ›Sonderschulbedürftigen‹ durch entsprechende Maßnahmen zu senken (vgl. ebd.). Ferner wurde die Durchlässigkeit zwischen Sonderschulen und allgemeinen Schulen gefordert. Sogenannte ›Grenzfälle‹, also Kinder und Jugendliche, die man als leichter behindert bezeichnete, sollten durch Differenzierungsmaßnahmen in der allgemeinen Schule bestmöglich gefördert werden. In der nachfolgenden Empfehlung des Deutschen Bildungsrates von 1973 wurde erstmals die weitgehende gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung vorgesehen bzw. eine Ermöglichung sozialer Kontakte gefordert. Insofern bildete die Empfehlung den Beginn der Debatte um eine gemeinsame Erziehung und damit gegen eine schulische Isolation von Kindern und Jugendlichen mit zugeschriebener Behinderung (vgl. ebd.). Damit gingen die ersten Modellversuche integrativen Unterrichts in München, Berlin, Bonn, Hamburg und Köln einher (vgl. ebd.). »Eine bedeutende Rolle i. S. einer kritischen Begleitung der Integrationsbewegung« (Feuser 2018, 212) spielte die in den 1970er Jahren gegründete Krüppelbewegung, die sich als Selbstvertretungsbewegung aktiv in Bereichen der Behindertenpolitik einbrachte (vgl. Achtelik 2015)33.
Während sich also die Situation für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zugeschriebener geistiger Behinderung in den 1960er und 1970er Jahren verbesserte, waren Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung nach wie vor von Schulbildung, Förder- und Arbeitsangeboten ausgeschlossen und lebten entweder zu Hause, in konfessionellen Heimen oder in psychiatrischen Anstalten.
Mit dem Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland »Zur psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung« (der sog. Psychiatrie-Enquete) wurde 1975 auf die Missstände in den psychiatrischen Krankenhäusern in Deutschland verwiesen. Es wurden schwerwiegende Mängel bei der Versorgung psychisch Kranker und Menschen mit Behinderung aufgezeigt. Unter anderem wurde festgestellt, dass eine sehr große Anzahl dieser Menschen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müssen. Weiterhin wurde auf die mangelhafte Ausstattung an Ärztinnen* sowie pflegerischen bzw. sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen* hingewiesen (vgl. Deutscher Bundestag 1975). Ein weiterer wesentlicher Punkt war die ›Fehlplatzierung‹ von Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung in den Abteilungen psychiatrischer Anstalten (vgl. ebd.). 1975 waren 18,5 % der Patientinnen* in den psychiatrischen Krankenhäusern, rund 17.400, Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung. Diese können in den psychiatrischen Krankenhäusern nicht die erforderliche heil- und sozialpädagogische Behandlung erhalten (vgl. ebd.). Der damit einsetzende Prozess der Enthospitalisierung war und ist ein langwieriger und noch nicht abgeschlossener Prozess. Noch Mitte der 1990er Jahre zeigte sich, dass immer noch tausende Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in der Bundesrepublik ›fehlplatziert und fehlbetreut‹ in psychiatrischen Krankenhäusern und isolierenden Pflegeeinrichtungen untergebracht waren. Im sog. Magdeburger Appell 1993 wurde deshalb eine »[…] sofortige Umwandlung von Stationen in psychiatrischen Einrichtungen und Pflegeheimen zu kleinen, gemischt-geschlechtlich belegten Wohngruppen unter pädagogischer Leitung […]« (Straßmeier 2000, 2) gefordert. Im Ergebnis zeigte sich allerdings häufig, dass sich allein durch die ›Umwandlung‹ in Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Bedingungen für das Leben der Menschen wenig änderten, da die Grundstrukturen erhalten blieben. Das »psychiatrische Klinik-Modell« und die Strukturen einer »totalen Institution« (vgl. Goffman 1961) wurden damit zum Teil tradiert (vgl. Straßmeier 2000, 6).
Des Weiteren muss kritisch resümiert werden, dass es nach wie vor, sowohl auf dem Gebiet der sogenannten alten als auch der neuen Bundesländer, Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung gibt, die in Abteilungen psychiatrischer Krankenhäuser leben. Häufig sind es Menschen mit schweren Hospitalisierungserscheinungen oder anderen sogenannten Verhaltensstörungen, von denen angenommen wird, dass sie nicht in Einrichtungen der Behindertenhilfe eingliederbar sind.
Zeitgleich mit der Enthospitalisierung wurden zunehmend Kinder und Jugendliche mit sogenannter schwerer und mehrfacher Behinderung an ›Schulen für Geistigbehinderte‹ aufgenommen. Das Recht auf pädagogische Fördermaßnahmen für jedes Kind mit der Diagnose geistige Behinderung, unabhängig von deren Schwere, wurde allerdings erst 1979/1980 mit den »Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte« (KMK 1980, 4; Lamers & Heinen 2006) der Kultusministerkonferenz festgeschrieben. Diese Entwicklung ging mit der Etablierung besonderer heilpädagogischer Ansätze, wie der Basalen Stimulation, der Basalen Aktivierung, der heilpädagogischen Übungsbehandlung und verschiedenen Therapieformen wie Ergo- und Physiotherapie einher und ermöglichte ihnen erstmals unterrichtliche Teilhabe.