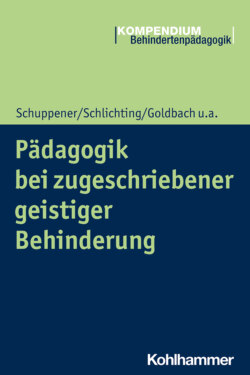Читать книгу Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung - Anne Goldbach - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Definitorische Annäherungen
Оглавление»Behinderung steht […] ›für etwas‹ und ›ist‹ nicht im eigentlichen etwas« (Moser 2015, 11; Hervorhebung i. O.).
Die oben skizzierte unverhandelbare Dimension der Zuschreibung steht für uns auch im Zentrum definitorischer Annäherungen an ein Verständnis dessen, was mit dem Attribut einer ›Geistigen Behinderung‹ – stets standortgebunden (!) – in Verbindung gebracht wird. Wir schließen uns Dederich (2009) an, der sehr treffend die grundlegenden Herausforderungen definitorischer Annäherungen zusammenfasst und als »schwerwiegendes Problem« der Sonderpädagogik benennt:
»Wie ist es möglich, wissenschaftlich adäquat, philosophisch und soziologisch reflektiert und an den Erfordernissen der Praxis orientiert über Behinderung zu reden, ohne mit (sonder-)anthropologischen Denkfiguren, Wesensbeschreibungen, festgeschriebenen Merkmalskatalogen usw. zu operieren?« (18).
Als offene Antwort verweist er – mit Bezugnahme auf Felkendorff (2003) – auf eine Reihe von Argumentationen, die gegen differente Definitionen von Behinderung im Allgemeinen vorgebracht wurden und die wir z. T. auch im Rahmen begrifflicher Unzulänglichkeiten oben schon angedeutet haben:
Definitionen …
• führen zu Stigmatisierung,
• wirken essenzialistisch,
• sind defizitär und betonen Negativmerkmale,
• sind ein willkürliches Konstrukt,
• können höchst unterschiedliche und komplexe Phänomene nicht zusammenfassend beschreiben,
• transformieren ein sozial bedingtes Phänomen in ein individuelles Problem,
• tragen zu sozialer und institutioneller Segregation bei,
• werden zur Untermauerung und Ausweitung professionsbezogener Zuständigkeiten missbraucht,
• determinieren die damit adressierte Gruppe auf bestimmte Verhaltensweisen und Entwicklungsmöglichkeiten,
• haben keine pädagogische Aussagekraft.
Auch beim Versuch einer Definition von so genannter ›Geistiger Behinderung‹ lassen sich die genannten (Gegen)Argumente alle sehr deutlich wiederfinden. Gemein ist allen (fachlichen/disziplinären) Definitionen der Standort der Außenperspektive, bei welchem das persönliche Kategorienschema der Definierenden (= oftmals Menschen ohne Behinderungserfahrungen) dominiert. So gilt die Aussage Feusers auch heute noch ungebrochen: »Es gibt Menschen, die wir aufgrund unserer Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem wir sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den wir als ›geistigbehindert‹ bezeichnen« (Feuser, 1996, 18; Hervorhebungen i. O.). Nicht nur begriffliche Vorschläge und Fassungen, sondern gleichsam auch Definitionsversuche des ›Phänomens Geistige Behinderung‹ und des so konnotierten Personenkreises basieren stets auf externen Zuschreibungen und verkörpern einen ›Blick von außen‹, der vorrangig spekulativen Charakter hat. Ihnen wohnt immer das Risiko der Produktion und Re-Produktion von Differenzmustern inne, die auf einer Wahrnehmung von Andersheit im Sinne von Mangel und Unvollständigkeit (vgl. Danz 2015) basieren und auf einer zwangsläufigen Normorientierung fußen. Damit bedienen viele Definitionen den Othering-Prozess ( Kap. I, 3.3) und erweisen sich weder als intersektionalitätssensibel noch als reifikationssensibel.
Verfolgt man den so genannten (sonderpädagogischen) Fachdiskurs, herrscht seit vielen Jahren eine weitgehende fachliche Einigkeit darüber, dass eine so genannte Geistige Behinderung nicht mehr an personenbezogenen Definitionskriterien festgemacht, sondern als Situation eines Individuums beschrieben wird, in welcher ein außergewöhnlicher Assistenzbedarf innerhalb verschiedener Entwicklungs- und Lebensbereiche vorliegt (vgl. Speck 2005). Diesbezüglich hat Feuser schon 1976 eine Definition vorgeschlagen, die dem »sozialen Modell von Behinderung« entspricht und damit nach wie vor aktuelle Relevanz hat:
»Stellen wir fest, daß als geistigbehindert gilt, wer aufgrund organisch-genetischer Defekte und der infolge davon auftretenden Störungen oder aufgrund andersweitiger Schädigungen, insbesondere durch Beeinträchtigungen infolge soziökonomischer Benachteiligung und sozialer Isolation, in seinen Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten, die sich besonders im Zusammenhang von Wahrnehmung, Denken und Handeln sowie in der Sensomotorik zeigen, derart beeinträchtigt ist, daß er angesichts der vorliegenden Lernfähigkeit zu Befriedigung seines besonderen Erziehungs- und Bildungsbedarfs voraussichtlich lebenslanger spezielle pädagogischer und sozialer Hilfen bedarf « (708).
Seit den 1970er Jahren werden in vielen definitorischen Annäherungen nach wie vor differente Entwicklungsbereiche angesprochen, die als beeinträchtigt gelten, wenn man von einem Normvergleich mit privilegierten Menschen ohne Behinderungserfahrungen als Normhorizont ausgeht. Dies erfolgt zumeist entlang einer sichtbaren/beobachtbaren Erscheinungsebene – »nahe am anschaulichen Pol« (Ziemen 2002, 29) – und in einer sehr tiefgreifenden Form, da stets alle Entwicklungsbereiche genannt werden: Soziale Beziehungen, Wahrnehmung, Bewegung & Mobilität, Kognition & Lernen, Kommunikation & Sprache, Emotionale Befindlichkeit (vgl. Fischer 2016). Damit fußen Definitionen einer so genannten Geistigen Behinderung in der Regel auf negativ konnotierten Differenzmarkierungen in (allen) zentralen Entwicklungsbereichen und stellen demzufolge eine sehr tiefgreifende und stigmatisierende Zuschreibungskategorie dar.
Wir möchten auf eine konkrete ›Neudefinition‹ des Konstruktes Geistige Behinderung verzichten – nicht zuletzt, weil allein schon der Begriff nicht unsere Zustimmung findet (s. o.) – und stattdessen eher auf konstituierende Aspekte eingehen, die für ein Verständnis dessen, was mit einer ›Geistigen Behinderung‹ assoziiert wird, wesentlich sind. Dies erfolgt auf der Basis der Konturierung eines grundlegenden fragilen, brüchigen, vulnerablen Subjektverständnisses, welches stets (auch) durch Momente der Abhängigkeit und Unterwerfung (vgl. Butler 2001) geprägt ist ( Kap. I, 2.4). Dementsprechend soll eine Triangulation von sozialer Determiniertheit, Subjektivität & Vulnerabilität und Unbestimmtheit vorgeschlagen werden, welche auf einer tiefgreifenden Weiterentwicklung des »Triangulären Grundverständnisses von Geistiger Behinderung« von Schuppener (2007, 115) basiert. Damit wird die relationale Betrachtung des Etiketts ›Geistige Behinderung‹ und entsprechender Konsequenzen betont.
Ein von außen formuliertes Verständnis dessen, was unter der Diagnose ›Geistige Behinderung‹ verhandelt wird, ist unseres Erachtens stets durch folgende anthropologische Anerkennungsfaktoren und -risiken geprägt:
1. Soziale Determiniertheit
Hierunter fallen äußere Einflüsse in Form von Be-Hinderungen durch gesellschaftliche Macht- und Differenzstrukturen sowie damit einhergehende Exklusionsrisiken für Menschen, die von Marginalisierung bedroht sind. Dazu zählen Personen, die mit der Diagnose einer geistigen Behinderung konfrontiert sind, in hohem Maß. Es vereint sich eine Vielzahl an Risikofaktoren für Menschen, die als normabweichend wahrgenommen werden. Diese Risiken lassen sich im Kontext einer protonormalistischen Gesellschaft als zwangsläufig kennzeichnen: Ausgrenzungserfahrungen, ›Andersartigkeitserfahrungen‹, Ablehnungserfahrungen, Institutionserfahrungen, ›Schonraumerfahrungen‹, Fremdbestimmungserfahrungen, Erfahrungen des ›Nicht-verstanden-werdens‹, Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen u. a. Derartige Strukturen sind als externe Einflüsse eine zentrale Bedingungsvariable für die Fortschreibung des Labels geistig behindert und haben gleichsam Einfluss auf die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Schuppener 2009, 2011a).
Die soziale Determiniertheit wird genährt durch eine ›Konstruktion des Anderen‹, über welche sich nach wie vor professions- und disziplinbezogen eine Sonderpädagogik legitimiert, die eine (Re)Produktion der Differenz von Menschen mit Behinderungserfahrungen in Abgrenzung zu einer vermeintlichen »Normalität« proklamiert. Es handelt sich damit um eine äußerst wirkmächtige und zentrale Einflussvariable (auch) auf das Konstrukt einer ›Geistigen Behinderung‹. Als eine Art Gradmesser für die Strukturen und Prozesse sozialer Determiniertheit lässt sich der Kernaspekt der Responsivität markieren. Versteht man Responsivität als »›Antwort‹ geben auf Ansprüche, Fragen Anforderungen, Provokationen, Aufforderungen, Angewiesenheit, Begehren des Anderen« (Stinkes 2004, 86), so ist mit der Zuschreibung einer geistigen – insbesondere auch einer schweren und/oder mehrfachen – Behinderung immer eine responsive Irritation verbunden: Soziale Situationen und Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne zugeschriebene Behinderungen sind nicht selten durch massive Unsicherheiten im Dialog geprägt. Hieraus kann eine Attribution von Fremdheit entstehen, wobei Fremdheit hier im phänomenologischen Sinne als interne und externe Fremdheit des Ausdruckverhaltens (vgl. Stinkes 2004) verstanden wird. Stinkes (ebd.) spricht hier von einer »intersubjektiven Angewiesenheit« (87), in welcher sich besonders Menschen befinden, die aufgrund eingeschränkter Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten deprivilegiert sind. Ein erweitertes Verständnis von Responsivität in der Leibphänomenologie fußt auf einer Öffnung gegenüber dem Fremden und einer Orientierung auf ein »gemeinsames Handeln« im Sinne einer »responsiven Leiblichkeit« (ebd., 88). Das schließt ein, dass mir der Anspruch einer Person, auf die ich reagiere/antworte, unzugänglich ist und hier stets eine grundlegende Offenheit als Kernanspruch pädagogisch-professionellen Handelns vorausgesetzt werden muss, den wir folgend in Punkt 3 noch aufgreifen möchten. Gleichsam soll das ›Risiko von Fremdheit‹ nicht unbemerkt bleiben, welches im Vorenthalten sozialer Anerkennung münden kann und zwangsläufig maßgeblichen Einfluss auf die Subjektivität und die Vulnerabilität eines Menschen hat.
2. Subjektivität und Vulnerabilität
Jedes Individuum entwickelt verschieden ausgeprägte Fähigkeiten zur Selbst- und Fremdregulation, die im hiesigen Modell als interne Bedingungen verstanden werden können. Der Begriff Subjektivität ist hier als ein »reflexives und offenes Verhältnis zu sich selbst« (Scherr 2013, 32) zu charakterisieren. Vor einem konstruktivistischen Hintergrund verweist er darauf, dass es keine existente Wirklichkeit jenseits des Subjektes gibt und eine Subjektkonstituierung immer im zwiespältigen »Spannungsfeld von Autonomie und Abhängigkeit« (Danz 2015, 46) stattfindet.
»Subjektivität kann als Synthese von Individualität und Identität aufgefasst werden« und »entsteht immer im Kommunikationszusammenhang, in dem das Subjekt anderen Subjekten begegnet« (ebd., 47). Im mitmenschlichen Aufeinanderangewiesensein (vgl. Adorno 1956) verkörpert Subjektivität als Selbstgefühl und Selbstwahrnehmung eine Grundannahme menschlicher Entwicklung: Alle »Individuen erleben sich selbst als mit bestimmten Bedürfnissen und Empfindungen ausgestattete Wesen« (Scherr 2013, 32).
Sowohl aus philosophischer als auch aus entwicklungspsychologischer Perspektive geht es in diesem Zusammenhang auch immer um eine Anerkennung von Unvollkommenheit und Imperfektion als Kennzeichen von Subjektivität, die wir als zentral erachten im Kontext konstituierender Faktoren der Zuschreibungsdiagnose Geistige Behinderung o. a.
Einem Euphemismus der Kompetenzorientierung vorbeugend soll die Reflexion zentraler Einflüsse auf ein mögliches Verständnis von sogenannter geistiger Behinderung nicht das konstitutive Merkmal der Vulnerabilität außer Acht lassen. Vulnerabilität in einem sozialpädagogischen Verständnis bedeutet Verwundbarkeit aufgrund der Zugehörigkeit zu einer deprivilegierten sozialen Gruppe (vgl. Castro Varela & Dhawan 2004) und steht damit »in direktem Zusammenhang mit Marginalisierungsprozessen« (Biewer et al. 2019, 14). Wir möchten uns von einem rein individuumszentrierten Vulnerabilitätskonzept distanzieren und eine erhöhte Verletzlichkeit und Sensitivität nicht als individuelle Disposition begreifen, die zudem ausschließlich negativ konnotiert ist, sondern als durch erhöhte Exklusionsrisiken bedingtes soziales Phänomen (vgl. Schäper 2006), was in Folge auch eine gesellschaftskritische Dimension hat (vgl. Burghardt et al. 2017). Es soll im hiesigen Verständnis nicht um ein gesundheitswissenschaftlich-psychologisches Vulnerabilitätskonzept (vgl. Theunissen 2007b) und dessen Überwindung im Sinne einer Resilienzstärkung – verbunden mit Befähigungs- und Ermächtigungsprozessen – gehen. Vielmehr soll der Fokus auf einer Anerkennung von Vulnerabilität liegen: »Vulnerabilität ist eine Frage, die nicht aufhört sich zu stellen« (Stöhr et al. 2019, 8), weil Verletzlichkeit, Abhängigkeit und Endlichkeit konstitutive Merkmale des menschlichen Lebens sind (vgl. Dederich 2007, Danz 2015). Vulnerabilität als »anthropologisches Merkmal« (Dederich 2007, 188) anzuerkennen, bedeutet eine Anerkennung des Gegenübers – und von sich selbst – als Subjekt mit einer individuellen, normgeprägten Lebensgeschichte: »Das ›Ich‹ hat gar keine Geschichte von sich selbst, die nicht zugleich die Geschichte seiner Beziehung – oder seiner Beziehungen – zu bestimmten Normen ist« (Butler 2018, 15). Anerkennungsverweigerungen gleichen daher zwangsläufig einer Entsubjektivierung und führen vor diesem Verständnis zu Entmenschlichung. Für das Individuum entsteht durch derartige Anerkennungsdefizite eine oben skizzierte riskante Form der Vulnerabilität und es kommt zur möglichen Ausweitung von »Integritätsverletzungen« auf der Subjektebene (vgl. Honneth 2003).
Neben der Anerkennung von Vulnerabilität als menschliches Wesensmerkmal ergeben sich – verbunden mit dem Subjektivitätsverständnis – folglich zwei (spezifische) Anerkennungsdimensionen im Hinblick auf Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung: die Anerkennung potentieller subjektiver Leidsituationen – als Grundlage für Empathie und Solidarität (vgl. Gottwald & Dederich 2009) – und die Anerkennung erhöhter Verletzlichkeit aufgrund hegemonialer gesellschaftlicher Wirkkräfte sowie möglicher Selbstnormalisierungen und Selbstpathologisierungen (vgl. Boger 2018) etc., aber eben gleichsam auch die Anerkennung etwaiger besonderer Aneignungs- und Bewältigungsstrategien im Umgang mit vulnerablen Bedingungen.
3. Unbestimmtheit
Der Begriff der Unbestimmtheit wurde im sonderpädagogischen Diskurs u. a. von Rödler (1993, 2000a, b) geprägt und stellt sich bewusst gegen die kategorialen Wesensmerkmale eines Menschen, welche im Kern stets ableistische und leistungsorientierte Grundannahmen implizieren. Mit dem Merkmal der Unbestimmtheit lässt sich eine Art voraussetzungslose Entwicklungsoffenheit assoziieren, die eine Gültigkeit für alle Menschen hat und damit eine »anthropologische Qualität« (Rödler 2000a, 152) verkörpert. Gerade vor dem Hintergrund des Konzeptes der anthropologischen Differenz (vgl. Kamper 1973 in Stinkes 2010) muss jedoch betont werden, dass die Unbestimmtheit sich nicht auf das Subjekt selbst bezieht, weil dies einer illegitimen »abstrakten Idee vom Menschen« (Adorno 1959, 173 in Stinkes 2010, 118) entsprechen würde, sondern vielmehr auf das Gegenüber im zwischenmenschlichen Verhältnis in Form eines ›Nicht-Verstehens‹. So ist das ›Behindert werden‹ in sozialer Hinsicht (vgl. 1.) geprägt durch das ›Nicht-Verstehen‹ von Menschen ohne Behinderungserfahrungen. Um diesem Dilemma konstruktiv entgegen zu wirken, sollte es zu einer grundlegenden Akzeptanz des Nicht-Verstehens kommen: Man kann und muss ein Gegenüber nicht vollständig verstehen. Man sollte die Suche nach Verstehen und Verständigung auch nie aufgeben (vgl. u. a. die Rehistorisierung nach Jantzen 2006), aber es sollte keine voraussetzungsvolle Wirkmacht entfalten, im Sinne einer Determinierung und Kategorisierung von Menschen (= »Wen ich nicht verstehen kann, nehme ich als fremd wahr und werte ihn ab!«). Es geht hier demnach um eine Anteiligkeit der Unbestimmtheit, die nicht bestreitet, dass Menschen grundlegend stets deutungsabhängig sind vom Gegenüber in Dialog und Interaktion (vgl. Stinkes 2010). Es sollte jedoch zu einem offenen Umgang mit der Deutungsabhängigkeit und einem Anteil des Nicht-Verstehens kommen; nur so kann das Nicht-Verstehen eine dialogische Qualität entwickeln und zu einer Überwindung von Distanzierung und Entdemokratisierung beitragen. Das Zulassen bzw. die Akzeptanz eines Nicht-Verstehens können herausfordern, aber genau damit auch ein Beitrag zur Entwicklung einer Form der Empathie und der Solidarität im Miteinander sein.
Im Bereich der Profession einer Pädagogik der Verbesonderung verweist die Dimension der Unbestimmtheit auch auf eine zentrale Grundfigur professionellen pädagogischen Handelns (vgl. Helsper, Hörster & Kade 2005), auf welche wir im weiteren Verlauf ( Kap. II, 3.2) nochmal eingehen.
Abb. 1: Trianguläres Grundverständnis differenter Anerkennungs- und Zuschreibungsfaktoren im Kontext des Etiketts ›Geistige Behinderung‹
Das trianguläre Grundverständnis soll verschiedene Anerkennungsfaktoren und Anerkennungsrisiken dessen aufzeigen, was konstitutiv ist für ein subjektorientiertes, (de)konstruktivistisches Verständnis einer sogenannten Geistigen Behinderung. Damit soll es quasi eine Art Hintergrundschablone für die Reflexion von Definitionen und Beschreibungen des so bezeichneten Personenkreises sein. Implizit ist diesem Grundverständnis einerseits, dass alle drei Merkmalsebenen zunächst in verbindender Form alle Menschen betreffen und vereinen. Andererseits dient das Modell auch dazu, besondere Risikofaktoren, welche mit der Zuweisung einer Geistigen Behinderung einhergehen, nicht zu verleugnen, sondern offen zu legen und innerhalb der Disziplin immer wieder (neu) zur Diskussion zu stellen30. Somit lässt sich bilanzieren, dass dieses Grundverständnis immer (auch) einen »nicht gelungene(n) Umgang mit Verschiedenheit« (Ortland 2008, 11) markiert.
Hinsichtlich der grundlegenden Frage nach der Bedeutsamkeit von Definitionen sollte man Folgendes berücksichtigen: Die Funktion von (definitionsbezogener) Sprache liegt zum einen in der zwischenmenschlichen Verständigung, »darf aber zum anderen auch nicht die Unbestimmtheit der Menschen in Frage stellen« (Rödler 2000, 153). Mit diesen beiden gegensätzlichen Ansprüchen lässt sich auf das eingangs bekundete Dilemma im Kontext von Kategorisierungen verweisen, was auch hier lösungsoffen bleibt:
Es muss einerseits kritisch reflektiert werden, dass Sprache ein wirkmächtiges Instrument in unserer Gesellschaft darstellt und die Definitionsmächtigen zu einer Reflexion dieses Machtinstrumentes verpflichtet sind, welches »in herrschaftlicher Weise die (soziale) Exklusion« (Feuser 2016, 48) von Menschen legitimiert, die als geistig behindert adressiert werden.
Und es muss andererseits konstatiert werden, dass es eine ›unausweichliche Euphemismusfalle‹ in begrifflicher und definitorischer Hinsicht zu geben scheint, da nach wie vor keine Bezeichnung und kein Verständnis von so genannter Geistiger Behinderung existiert, welche nicht das Benennen von hierarchischen Unterschieden bedient und somit eine Negation impliziert.
17 »Eine wissenschaftliche Pädagogik wird dem Problem nicht ausweichen können, dass Begriffe im Laufe der Zeit anders gewertet werden« (Biewer & Koenig 2019, 43). Daher muss sie sich den entsprechenden (Begriffs)Veränderungen und damit verbundenen Diskursen offen stellen.
18 Ackermann (2010) macht auf das Vakuum begrifflicher Klärung aufmerksam, indem er anmerkt, dass es in der Fachliteratur so gut wie keinen Hinweis darauf gibt, was man unter geistiger Entwicklung versteht und demzufolge auch eine Definition von Geist im Selbstverständnis einer sogenannten ›Geistigbehindertenpädagogik‹ schwer zu finden ist.
19 vgl. AAIDD: https://aaidd.org/home (27.03.2020) und IASSID: https://www.iassidd.org/ (27.03.2020).
20 Im alltäglichen Sprachjargon finden sich häufig noch personifizierte Benennungen (›Geistigbehinderte‹) sowie weitere diskriminierende Bezeichnungen (›mongoloid‹ oder ›Downie‹).
21 Hier möchten wir an die in der Einführung erwähnte Kritik von Raul Krauthausen erinnern: »Ich kenne keinen Menschen mit Behinderung, der sich mit ›besonderen Bedürfnissen‹ beschrieben hören will.« Und er ergänzt hier: »Menschen jeden Alters werden allgemein als negativer empfunden, wenn man sie mit ›besondere Bedürfnisse‹ statt mit ›behindert‹ beschreibt.« (Hervorhebungen i. O.): https://raul.de/leben-mit-behinderung/warum-ich-das-wort-besonders-nicht-mehr-hoeren-kann/ (14.03.2020).
22 weder von Fachvertreterinnen* noch von Selbstvertreterinnen*: Die Interessensvertretung der Lebenshilfe Berlin e. V. (Berliner Rat) spricht sich bspw. für den Terminus ›Menschen mit Beeinträchtigungen‹ aus: https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/ueber-uns/interessenvertretung.php (08.04.2020).
23 httphttp://gruppe-mitsprache.ch/unsere-forderungen/ (15.03.2020).
24 Offen bleibt für Außenstehende auch immer die Frage nach der Genese von Begriffsvorschlägen seitens unterschiedlicher Selbst-/Interessensvertreterinnen*verbände: Wer bringt welche Vorschläge mit welcher Sprach- und Diskussionsmacht ein? Und vor dem Hintergrund welcher Abstimmungsprozesse kommt es dann zu einem finalen Votum?
25 https://leidmedien.de/begriffe/ (21.03.2020).
26 »Die Welt braucht keine Kategorien. Wir Menschen sind es, die sie brauchen. Wir konstruieren Kategorien, um uns durch diese komplexe, widersprüchliche Welt zu navigieren, um sie irgendwie zu begreifen und uns über sie zu verständigen« (Gümüşay 2020, 133).
27 »Mehr als 70 Millionen Menschen werden zu dem Geflüchteten. 1,9 Milliarden Menschen werden zu dem Muslim. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird zu der Frau. Der Schwarze Mann. Die Frau mit Behinderung. Der Afrikaner. Die Homosexuelle. Der Gastarbeiter. Die non-binäre Person« (Gümüşay 2020, 134; Hervorhebungen i.O.).
28 Ein (historischer) Blick auf Diskurse zum ›(Geistige) Behinderungsbegriff‹ zeigt, dass jeder Alternativbegriff vermutlich in absehbarer Zeit eine ähnliche Negation erfahren würde wie auch entsprechende Vorläuferbegriffe.
29 Es widerstrebt uns als Autorinnen ohne Behinderungserfahrungen, einen alternativen Terminus auszuwählen und als gleichermaßen akzeptabel für fachliche Außenperspektiven-Kontexte sowie subjektive Innen-Perspektiven von Personen mit Erfahrungen mit dieser Zuschreibung deklarieren zu können.
30 Mit diesem Anspruch lässt sich insbesondere auch auf die »Figuren einer nicht ausgrenzenden Pädagogik« von Bernasconi und Böing (2015, 79 f.) verweisen, welche dem übergreifenden Anspruch einer transdisziplinären Verortung folgen: Ungewissheit, Imperfektibilität und Stellvertretung.