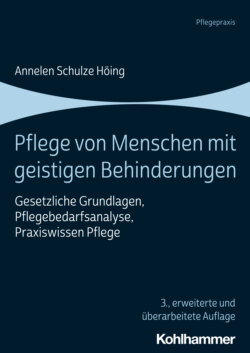Читать книгу Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen - Annelen Schulze Höing - Страница 59
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Anforderungen an die Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen
ОглавлениеMenschen mit geistigen Behinderungen durchlaufen entwicklungspsychologisch andere Wege als Menschen ohne geistige Behinderungen. Daher sind »normale« Verhaltensregeln häufig nicht anwendbar. Ein adäquates Verstehen, Einordnen und Reagieren auf Verhaltenweisen geistig behinderter Klienten setzt einen intensiven, teilweise über Monate und Jahre gepflegten Beziehungsaufbau zwischen Klient und Mitarbeiter voraus. Die Kommunikation und die Gestaltung des Beziehungsprozesses während der Pflegehandlung erfolgen vielfach auf der nonverbalen Ebene und erfordern von den Mitarbeitern ein hohes Maß an sozialer und kommunikativer Kompetenz sowie eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe.
Von besonderer Bedeutung ist auch die Interpretation von Symptombildern, da Symptome häufig in untypischer Weise zum Ausdruck kommen. Die ärztliche Anamnese und Diagnostik ist erschwert, weil diese häufig als Fremdanamnese erhoben werden muss. So ist die Ärztin auf die genaue Beobachtung, fachgerechte Verlaufsdokumentation und Informationsweitergabe aller am Prozess der Betreuung Beteiligten angewiesen.
Weil sich Klienten häufig in verschiedenen Betreuungssettings (z. B. Besondere Wohnangebote, Förderstätte oder Werkstatt, Betreuung durch Angehörige und Therapeuten) bewegen, kommt es bei der Krankheits- und Verhaltensbeobachtung zu Informationsverlusten. »Die richtige Einordnung des Beschwerdebildes wird durch eine duldende Haltung des Menschen mit Behinderungen, die zu einer Diskrepanz von Schwere der Symptome und zugrunde liegenden Beschwerden führt, zusätzlich erschwert« (Nicklas-Faust, 2006, S. 23).
In der Pflege von Menschen mit Behinderungen ist ferner zu berücksichtigen, dass diese einen erschwerten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben und Krankheiten in anderen Häufigkeiten auftreten. »So stellte sich in einer Untersuchung an Menschen mit geistiger Behinderung heraus, dass diese durchschnittlich an 2,5 gravierenden und 2,9 weniger schwerwiegenden Gesundheitsstörungen litten, die nur etwa zur guten Hälfte bekannt waren und nur zur Hälfte angemessen behandelt waren« (ebd., S. 24).
Im Erkrankungsmuster gibt es laut Nicklas-Faust (2006) deutliche Häufungen für Erkrankungen der Sinnesorgane, neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Nach Erfahrung der Autorin hat ein Teil der praktizierenden Ärzte nur unzureichende Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Diagnostik und medizinische Versorgung von Menschen mit geistigen Behinderungen.
Pflegenden in der Behindertenhilfe kommt daher eine besondere Rolle in der Krankenbeobachtung und der Einleitung medizinischer und pflegerischer Maßnahmen zu. Laut Nicklas-Faust belegt eine Studie jedoch eine große Diskrepanz zwischen Einschätzung der Betreuungspersonen und den objektiven Untersuchungsbefunden, was einen weiteren Erschwernisfaktor in der Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung darstellt (vgl. Nicklas-Faust, 2006).
Die Besonderheit liegt demnach nicht in den Pflegetechniken, sondern in den komplexen Anforderungen, die in der Pflege von Menschen mit geistigen Behinderungen zu berücksichtigen sind.
Daher werden Sie keine neuen Pflegemethoden für den Behindertenbereich in diesem Buch finden. Die Pflegetechniken orientieren sich an aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Beispielsweise wird eine Dekubitusprophylaxe immer nach denselben Prinzipien – der Druckentlastung, Förderung der Mobilität und Hautpflege – erfolgen. Diese Erfolgsfaktoren zur Gesundheitsförderung sind unabhängig von der geistigen Verfassung der Klienten. Die Unterschiede liegen in den Voraussetzungen zur interaktiven Beziehungsgestaltung. So sind den Möglichkeiten der verbalen Interaktion und Kommunikation, der Schulung und Beratung von Menschen mit Behinderungen durch die kognitiven Möglichkeiten klare Grenzen gesetzt.
Die in diesem Buch beschriebenen Instrumente (wie z. B. der Schmerzerfassungsbogen für Menschen, die sich verbal nicht äußern können) helfen Mitarbeitenden, ihre Klienten besser zu verstehen.