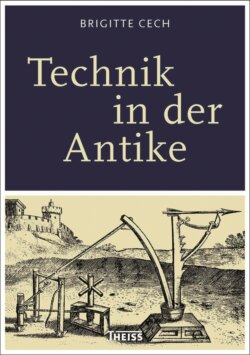Читать книгу Technik in der Antike - Brigitte Cech - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sonnenuhren
ОглавлениеEine Sonnenuhr besteht aus dem Gnomon – dem Schattenstab – und der Uhrenfläche mit drei Datumslinien für die Äquinoktien und die Solstitien, sowie elf Stundenlinien. Die mittlere der Stundenlinien ist der Meridian, die Mittagslinie. An den Äquinoktien bewegt sich die Schattenspitze im Laufe des Tages entlang der Äquinoktiallinie. Einzig zur Zeit der Äquinoktien entspricht die Länge der Temporalstunden der der Äquinoktialstunden, nämlich 60 Minuten.
Vitruv beschreibt in seinem Analemma (siehe auch Anhang 3), wie die Uhrenfläche einer Sonnenuhr, ohne astronomische Kenntnisse, nach den Methoden der darstellenden Geometrie mit Lineal und Zirkel zu konstruieren ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass die geographische Breite des Ortes, an dem die Sonnenuhr angebracht werden soll, bekannt ist. Vitruv gibt die Breite nicht als Winkel, sondern als Verhältniszahl der Länge des Gnomons zur Länge des Mittagsschattens an den Äquinoktien an. Für Rom sagt er, dass der Mittagsschatten an den Äquinoktien der Länge des Gnomons betrage. Allerdings beschreibt er nur die Konstruktion des Meridians einer Sonnenuhr mit horizontaler ebener Uhrenfläche, um dann mit folgenden Worten zu schließen: „Nachdem das auf diese Weise verzeichnet und entwickelt ist, werden unter Zugrundelegung des Analemmas, sei es durch Nachtgleichelinien oder auch durch Monatslinien, die Einteilungen der Tagesstunden auf den Auffangflächen aufgezeichnet werden müssen, und es werden dabei viele verschiedene Auffangflächen und Arten von Uhren gebaut“ (Vitr. 9, 7). Die Genauigkeit einer Sonnenuhr ist abhängig von der exakten Konstruktion der Uhrenfläche und der Länge und Positionierung des Gnomons nach dem Analemma, der korrekten Übertragung der analemmatischen Uhrenfläche auf die tatsächliche Fläche und die sorgfältige Ausrichtung, so dass sich die Schattenspitze zum Zeitpunkt des äquinoktialen Mittags genau im Schnittpunkt der Meridian- und der Äquinoktiallinie befindet.
Abb. 2 Uhrenflächen antiker Sonnen uhren: 1: horizontale ebene Sonnenuhr 2: Skaphe mit zentralem Gnomon 3: Skaphe mit Lochgnomon: Frontalansicht (3a) und Meri dianschnitt (3b) 4: Kegelsonnenuhr: Frontal ansicht (4a) und Meridian schnitt (4b), G: Gnomon, W/S: Winter- bzw. Sommer solstitial linie, Ä: Äquinok tiallinie, M: Meri dian (Mittagslinie)
Abb. 3 Römische Kegelsonnenuhr.
In der Antike gab es drei Grundtypen von Sonnenuhren:
1. Sonnenuhren mit horizontaler oder vertikaler ebener Uhrenfläche. Die Solstitiallinien dieser Sonnenuhren sind Hyperbeln. Bei vertikalen Sonnenuhren ist im Gegensatz zu horizontalen der Datumsbogen des Sommers olstitiums am größten (Abb. 2, 1).
2. Hohlkugelsonnenuhren mit kalotten- bis halbkugelfömiger Uhrenfläche. Wegen ihrer Form werden diese Sonnenuhren auch Skaphen (griechisch skaphion: Becken) genannt. Skaphen mit dem Gnomon am tiefsten Punkt der Schale werden horizontal aufgestellt (Abb. 2, 2), daher ist der Datumsbogen des Wintersolstitiums am größten. Skaphen mit einem Lochgnomon im Zenit der Halbkugel sind vertikale Sonnenuhren. In diesem Fall ist der Datumsbogen des Sommersolstitiums am größten (Abb. 2, 3).
3. Kegelsonnenuhren mit hohlkegelförmiger Uhrenfläche. Diese Sonnenuhren werden vertikal aufgestellt; der Datumsbogen des Sommersolstitiums ist am größten (Abb. 2, 4).
Daneben gab es Sonderformen, wie zum Beispiel Doppelsonnenuhren, aber auch tragbare Reisesonnenuhren.
Auf demselben Prinzip wie eine Sonnenuhr beruht der Meridian, der allerdings keine eigentliche Uhr, sondern vielmehr ein Kalender zum Ablesen des Datums ist. Er besteht aus einem Gnomon und der Mittagslinie, auf der die mittägliche Schattenspitze jedes Tages durch eine Linie gekennzeichnet ist. Im Jahr 10 oder 9 v. Chr. ließ Augustus in Rom einen Meridian anlegen, der mit seinem Mausoleum und der Ara Pacis („Altar des Friedens“) eine architektonische und propagandistische Einheit bildet. „Dem auf dem Marsfeld stehenden Obelisken gab der vergöttlichte Augustus eine bemerkenswerte Bestimmung, nämlich die Schatten der Sonne und auf diese Weise die Länge der Tage und Nächte anzuzeigen. Er ließ entsprechend der Länge des Obelisken ein Steinpflaster in den Boden legen, dem der Schatten der Wintersonnenwende in der sechsten Stunde gleichkommen sollte und der allmählich nach den aus Erz eingelegten Streifen an den einzelnen Tagen abnahm und wieder länger wurde“ (Plin. nat. 36, 72–73). Ausgehend von der bekannten Höhe des Gnomons (29,42 m) kann die Länge des augusteischen Meridians mit 62,26 m berechnet werden. Obwohl Plinius eindeutig einen Meridian beschreibt, wurde, ausgehend von der Höhe des Gnomons, eine Sonnenuhr rekonstruiert, die selbst unter Weglassung der äußeren Stundenlinien ein Ausmaß von 160 mal 75 m hat und vom Boden aus unmöglich abzulesen wäre. 1982 konnte bei archäologischen Untersuchungen auf dem Marsfeld, 1,6 m über dem augusteischen Niveau, ein kleiner Abschnitt eines wahrscheinlich an derselben Stelle befindlichen flavischen Meridians mit Monats- und Tageslinien freigelegt werden.