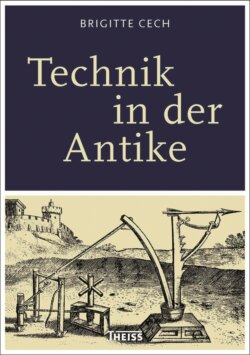Читать книгу Technik in der Antike - Brigitte Cech - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wasseruhren
ОглавлениеSonnenuhren haben den großen Nachteil, dass sie nur bei Sonnenschein brauchbar sind. Die Notwendigkeit, die Zeit auch in Räumen, bei Bewölkung oder nachts zu messen, führte zur Entwicklung der kleps(h)ydra (griechisch: Wasserdieb), der Wasseruhr, mit der die verstrichene Zeit an dem sich verändernden Wasserstand in einem Gefäß mit konstantem Abfluss (Auslaufuhr) oder Zufluss (Einlaufuhr) gemessen wird.
Die einfachste Wasseruhr beruht auf demselben Prinzip wie die – in der Antike allerdings unbekannte – Sanduhr und diente zur Messung einer relativen Zeitdauer. Durch eine kleine Öffnung rinnt Wasser von einem Gefäß in ein darunter stehendes zweites Gefäß. Uhren dieser Art wurden bei Gericht verwendet, um jedem Redner eine gleich lange Redezeit zuzumessen (Aristot. Ath. pol. 76, 2). Auch im militärischen Bereich kamen Wasseruhren zum Einsatz, um die Nacht in vier annähernd gleich lange Nachtwachen zu unterteilen. Ein Hinweis darauf findet sich bei Caesar (Caes. bell. Gall. 5, 13): „Wir konnten durch genaue Messungen mit der Wasseruhr (ex aquis) feststellen, dass hier [in Britannien] die Nächte kürzer sind als auf dem Kontinent.“
Große Wasseruhren, an denen man die Uhrzeit ablesen konnte und die in Städten oder bei Heiligtümern aufgestellt waren, sind zwar aus der antiken Literatur bekannt, aber leider nur selten, und wenn, nur in ihrer Basis erhalten. Eine Ausnahme stellt die Wasseruhr des 4. Jahrhunders v. Chr. im Amphiareion von Oropos, einer Stadt in Attika, dar. Es handelt sich dabei um eine Auslaufuhr mit einem großen Becken, aus dem täglich nachzufüllendes Wasser mit konstanter Geschwindigkeit abfließt. Ein mit einem Zeiger versehener Schwimmer zeigt auf einer Skala die Stunden an. Da die Zeit anhand des sich senkenden Wasserspiegels gemessen wird, befindet sich die 12. Stunde am unteren Ende der Skala. Entsprechend der antiken Stundeneinteilung mussten die Stundenmarken zu den Solstitien und Äquinoktien umgesteckt werden.
Die Erfindung der wesentlich komplizierteren Einlaufuhr, mit der die Uhrzeit über die in ein Becken einfließende Wassermenge gemessen wird, wird Ktesibios von Alexandria (3. Jh. v. Chr.) zugeschrieben (Vitr. 9, 8,2). Einlaufuhren setzen das Vorhandensein einer Wasserleitung und die Regelung des konstanten Einflusses in das Wasserbecken voraus. Dazu kommt, dass täglich zu Sonnenuntergang die Zuleitung abgesperrt und das Becken entleert werden muss. Bei der von Vitruv (Vitr. 9, 8,6–7) beschriebenen Einlaufuhr handelt es sich um ein technisch ausgereiftes Modell mit Regulierbecken und analemmatischer Uhrenfläche, auf der, entsprechend der Messung der Zeit anhand des sich hebenden Wasserspiegels, der oberste Bogen die zwölfte Stunde markiert. Aus einer Leitung, die mit einem Absperrhahn versehen ist, ergießt sich das Wasser in ein Regulierbecken, in dem sich ein kegelförmiger Schwimmer befindet, der durch den Wasserdruck in die Höhe gehoben wird. Bei starkem Druck in der Leitung schneidet der Schwimmer den Wasserzufluss ab. Ist das Wasser unten abgeflossen, senkt sich der Schwimmer und Wasser aus der Leitung kann nachfließen. Vom Regulierbecken fließt das Wasser in das Hauptbecken. Der steigende Wasserspiegel hebt einen Schwimmer, auf dem eine kleine Figur angebracht ist, die mit einer Rute auf einem drehbaren Zylinder, auf dem die Monate als vertikale Linien und die Stunden als horizontale Bögen markiert sind, die Uhrzeit anzeigt. Will man die Uhr auch nachts benutzen, dreht man den Zylinder um 180° und erhält so die jeweils gültigen Nachtstunden.