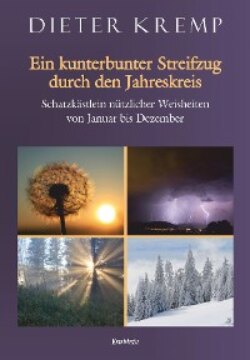Читать книгу Ein kunterbunter Streifzug durch den Jahreskreis - Dieter Kremp - Страница 53
VON DER VOGELSPRACHE UND VOM VOGELSANG
ОглавлениеBei Spaziergängen durch die Natur stoßen wir vor allem im Frühling bei jedem Schritt auf irgendwelche Tierstimmen oder Töne. Die meisten von ihnen werden von Vögeln ausgestoßen. Es ist bekannt, dass die Vögel fast immer zu hören sind. Aus der gesamten Reihe der Rufe entsteht eigentlich eine vollständige „Vogelsprache“, in der jeder Ruf einem bestimmten Zweck dient. Wir unterscheiden zwei grundsätzliche Gruppen von Stimmen: Das sind die Rufe, die die Vögel während des ganzen Jahres ausstoßen und der Gesang, den wir nur im Frühling während der Nistzeit hören. Ergänzend kann man noch Instrumentallaute erwähnen, wie zum Beispiel das rasche Klopfen mit dem Schnabel auf trockene Äste (Spechte) oder das Schnabelklappern bei Störchen. Bei den gesellig lebenden Vogelarten zum Beispiel bei den meisten Singvögeln, die nach dem Nisten Scharen bilden, ist die häufigste Lautäußerung das Lockrufen. Mit dem Lockruf wollen sich die Angehörigen der gleichen Art aufeinander aufmerksam machen, sich zusammenrufen, sich locken. Dann gibt es bei den Vögeln noch den Warnruf, der auf eine Gefahr aufmerksam machen soll. Es gibt aber auch noch andere Stimmen, wie zum Beispiel Angst- und Schmerzlaute, das Geschrei der Jungen und Bettelgezwitscher.
Die vollkommenste und auffälligste stimmliche Äußerung der Vögel ist ihr Gesang. Bei den meisten Arten sind es nur die Männchen, die singen. Mit ihrem Gesang wollen die Männchen im Frühling um Weibchen werben, er ist also auch ein Lockmittel. Doch ihr Gesang im Frühling wendet sich vor allem auch an die Männchen in der Umgebung, um denen damit zu sagen, dass hier in diesem Bereich ihr Nistrevier schon besetzt ist und durch den Gesang auch bewacht wird. Dringt jedoch trotzdem ein anderes Männchen in ein besetztes Revier ein, entflammt sofort ein Zweikampf, der mit der Vertreibung des Rivalen endet. Die beste Sängerin ist wohl die Nachtigall, deren Lied mehrere Strophen enthält.
Einmalig im Tierreich sind auch die Sommerkonzerte der Heuschrecken und der Grillen und das Frühlingskonzert der quakenden Froschmännchen. Mit ihrem Zirpkonzert in den Wiesen locken die Männchen Weibachen an. Das „Musikinstrument“ der Laubheuschrecken befindet sich an den beiden Vorderflügeln. Werden diese übereinander gerieben, entstehen die Zirplaute. Die Weibchen empfangen diese Töne mit besonderen Hörorganen an den Vorderbeinen. So finden sie ein Männchen, um sich mit ihm zu paaren. Zur Laichzeit der Frösche im Frühjahr ertönen lautschallend ihre Hochzeitskonzerte an den Weihern im Wiesental. Mit ihrem lauten Quaken locken die Männchen die Weibchen zum Eierablegen und zur Paarung ein. Unter den Vögeln ist es der Kuckuck, der bei der Rückkehr aus seinem Winterquartier seinen lauten Kuckucksruf im Wald erschallen lässt.
Leuchtkäfer finden im Sommer ihre Partner auf ganz andere Weise. Diese Käfer, die man auch Glühwürmchen nennt, haben ein kleines Glühlämpchen an ihrem Hinterleib, mit denen die flugunfähigen Weibachen in der Nacht die Männchen anlocken.
Eine ganz besondere Sprache haben die Bienen, die durch Tanzbewegungen ihren Artgenossen anzeigen, wo gute Futterquellen sind.
Die Amsel ist einer der ersten Frühlingsboten. Selbst wenn noch Schnee liegt, singt sie ununterbrochen ihre flötende Melodie. Der Gesang der Kohlmeise klingt wie „zizibäbä“, zizibäbä“. Die Lerchen trillern oder trällern in den Lüften, wobei ihr Lied an warmen Frühlingstagen mehrere Strophen umfasst und ungefähr zwei Minuten lang anhält. Schwalben zwitschern in den Lüften, die Zaungrasmücken lassen ihren Gesang wie das Klappern einer Nähmaschine erklingen: „dlidlidlidli!“ Spatzen pfeifen von den Dächern und das Goldhähnchen singt „sisisisisisisie“. Wahrlich, Singvögel haben Gold in der Kehle. Tauben gurren und Spechte trommeln mit ihren Schnäbeln an Baumstämmen im Wald. Der Buntspecht ist der Zimmermann des Waldes.
Der Star ist wirklich ein Star, ein Imitations-Künstler. Ob das Knarren einer Tür, Läuten der Straßenbahn, Kläffen des Dackels, Jaulen des Bussards oder Pfeifen der Meise – der Star ahmt all das so echt nach, dass Mensch und Tier sich irritiert umdrehen.
Lieblich, schwermütig, perlend, melodiös – so beschreiben Vogelfreunde das Lied des Rotkehlchens. Doch wenn der Vogel im Frühling einen Konkurrenten verjagen will, dann kann er sich bis zur Lautstärke einer Kettensäge steigern.
Der Zaunkönig ist ein stimmgewaltiger Zwerg. Wäre da nicht die Stimme: Ein melodisches Trillern und Schmettern mit leisen Zwischentönen, Strophen von jeweils fünf Sekunden Länge, die über weite Entfernungen schallen und so laut sind wie der Gesang kaum eines anderen Vogels. Dabei schmettert der Winzling seine Frühlingsklänge meist aus dem Dickicht hervor.
Die Schwalben, Mehl- und Rauchschwalbe, sind bekannt als Glücksboten, als Frühlingsboten und als die engsten Begleiter und Freunde des Menschen. Der Gesang der Rauchschwalben ist ein rasch fließendes, melodisches Zwitschern mit vielen Obertönen und einem Schnarren am Ende jeder Strophe. Dagegen ist das Lied der Mehlschwalben ein leises, leierndes, vokalarmes Zwitschern, ohne Schnarren am Ende.
Ende März erscheinen wieder die ersten Nachtigallen in Deutschland. Nach der Ankunft besetzt das Nachtigallenmännchen sofort ein Revier und beginnt zu singen. Die Weibchen treffen ein paar Tage später ein, vermutlich dient der Nachtgesang der Männchen zum Anlocken der nächtlich ziehenden Weibchen. Die Nachtigall ist wohl die bekannteste Sängerin unserer Vogelwelt. Ihr Gesang sei „so ausgezeichnet eigen, es herrscht darin eine so angenehme Abwechslung und eine so hinreißende Harmonie, wie wir sie in keinem anderen Vogelgesange wieder finden“, heißt es schon in der „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands“. Berühmte Komponisten haben sich von der Meistersängerin inspirieren lassen und ihren Gesang in Kompositionen nachempfunden: Ludwig van Beethoven etwa in seiner 6. Sinfonie, Johann Strauß in der „Nachtigallen-Polka“ und Igor Strawinsky im „Lied der Nachtigall“.
Bis zu 260 unterschiedliche Strophentypen beherrscht die Nachtigall – die sie aber ungeachtet ihres Namens nicht nur nachts vorträgt. Die meisten der zwei bis vier Sekunden langen Strophen beginnen mit leisen Anfangstönen, die oft die Imitation eines Vogelrufes enthalten. Darauf folgen laute, rhythmisch wiederholte Silben, die klangvoll aber auch schnarrend oder ratternd klingen können und als „Nachtigallschlag“ bekannt sind.
Besonders typisch sind die im Frühjahr nachts zu hörenden Pfeifstrophen. Die Nachtigall trägt dabei eine oft lange Serie von gedehnten, reinen Pfeiftönen vor, die einen weichen, wehmütigen Charakter haben können. Es entsteht der Eindruck eines Schluchzens. Innerhalb einer Stunde kann ein Nachtigallenmännchen mehr als 400 Strophen nacheinander vortragen.