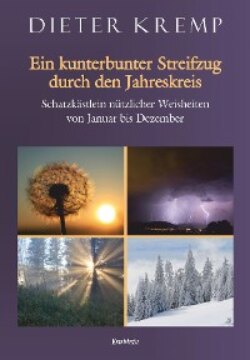Читать книгу Ein kunterbunter Streifzug durch den Jahreskreis - Dieter Kremp - Страница 64
DER HEILIGE HUGO HAT ES IN SICH
ОглавлениеDer Ruf „April, April!“ scheint einen fröhlichen Monat voller Scherz und Schabernack einzuleiten. Es bereitet ein spitzbübisches Vergnügen, die lieben Mitmenschen straffrei „in den April zu schicken“. Öfter ist dabei die Freude nur auf einer Seite groß – der Gefoppte steht eher wie ein begossener Pudel da. Wer an diesem Tage alles glaubt, was ihm vorgeflunkert wird, ist selbst schuld. Und bei den Aprilscherzen mischen die Tageszeitungen heute tüchtig mit: Da werden Projekte und Veranstaltungen „blumig“ angekündigt, die es gar nicht gibt. Und immer wieder fallen allzu Wissbegierige auf diese Aprilspäße herein.
Dabei ist der erste April der Namenstag des heiligen Hugo, der fürwahr kein Narr war, sondern ein ernster Mönch und Bischof von Grenoble und als solcher maßgeblich an der Entstehung des Ordens der Kartäuser beteiligt. Der Patron gegen Kopfschmerzen mag demjenigen Kopfschmerzen bereiten, der sich allzu leichtgläubig in den April schicken lässt und dann von seinen Mitmenschen aus gelacht wird.
Der Tag ist auch dem heiligen Cäsarius geweiht, einem engen Gefährten und Ordensbruder von Franz von Assisi. Der galt bei unseren Vorfahren auch als Wetterheiliger: „Wenn Cäsarius Spektakel macht, gibt’s Heu und Korn in voller Pracht.“ Oder es heißt am Narrentag: „Der 1. April treibt sein Spiel, treibt er’s toll, wird die Tenne recht voll.“ Beide Wetterregeln sind ein Hinweis auf die Unbeständigkeit des Aprilwetters.
In vielen europäischen Ländern ist es an diesem Narrentag Brauch, Aprilscherze zu ersinnen, andere zum Aprilnarren oder Aprilgecken zu machen. Meist geht es darum, jemanden mit einer lügnerischen Nachricht oder einem nicht auszuführenden Auftrag auf den Leim gehen zu lassen.
Früher war der erste April ein Spaßtag für Herren, Erwachsene, Meister und Familienoberhäupter. Kinder, Lehrlinge und Knechte, die Kleinen und Schwachen also, wurden zu unsinnigen Besorgungen losgeschickt und bei der Rückkehr gebührend ausgelacht: Fliegenfett, trockenes Eis oder gedörrten Schnee sollten sie aus der Apotheke holen, ungebrannte Asche beim Kohlenhändler oder Hühnergräten beim Fleischer. Heute ist es eher umgekehrt: Der 1. April ist eine wunderbare Gelegenheit für die Kinder geworden, mit kleinen harmlosen Streichen und Neckereien etwas Leben in die Welt der Erwachsenen zu bringen. Wer hätte sich schon früher getraut, einen Lehrer in den April zu schicken?
Über den Ursprung der seit dem 17. Jahrhundert verbreiteten Sitte des Aprilschickens gibt es viele Vermutungen, aber letztlich bleibt die Herkunft ungeklärt. Das um diese Zeit des Jahres gefeierte Narrenfest der Römer oder ein noch älteres indisches Narrenfest mögen Vorläufer gewesen sein – vielleicht aber auch die Tatsache, dass Christus (in der Karwoche) in Szenen alter Passionsspiele „von Pontius zu Pilatus“ (von Hamas zu Kaiphas, von Pilatus zu Herodes) hin- und hergeschickt wurde. Eine volkstümliche Deutung, vielleicht mit einem Fünkchen Wahrheit, sieht eben im launischen Aprilwetter die Ursache der Aprilscherze. In Frankreich soll sich der Glaube halten, der 1. April sei der Geburts- oder Todestag von Judas, dem Verräter – durch ihn hätte der Teufel Gewalt über den Monat April erlangt. Nach einer anderen Deutung ist Karl IX. daran schuld, der im Jahre 1564 den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar verlegte. Wer das vergaß, traf seine Vorbereitungen umsonst.