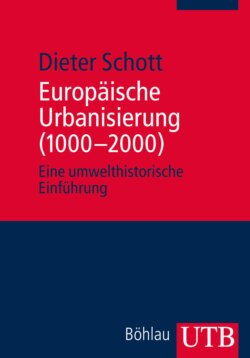Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 11
2 Kontinuität oder Neubeginn: Städte im Frühmittelalter 2.1 Römerstädte: Das Problem der Kontinuität
ОглавлениеIn diesem Kapitel soll veranschaulicht werden, an welche älteren Formen städtischer Siedlungen die europäische Urbanisierung des Hochmittelalters anknüpfen konnte oder ob und in welchem Umfang die Gründung von Städten eine neue Entwicklung darstellte. Außerdem werden die wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen für die europäische Urbanisierung charakterisiert und unterschiedliche Wege zur Stadtentstehung präsentiert.
Hatte die ältere Stadtgeschichte, vorrangig interessiert an rechts- und verfassungsgeschichtlichen Fragestellungen, sehr stark den Bruch, die Diskontinuität zwischen den römischen städtischen Traditionen und dem Wiederaufstieg städtischer Siedlungen im Hochmittelalter betont, so überwiegt mittlerweile eine funktionalistische Interpretation, die stärker auch Kontinuitäten akzentuiert.1
Woran konnten mittelalterliche Städte nun anknüpfen, wodurch zeichneten sich Römerstädte aus? Insbesondere im Raum nördlich der Alpen gibt es eine Reihe klarer Merkmale: Hervorgegangen aus der Tradition eines Militärlagers weisen Römerstädte in der Regel einen quadratischen oder rechteckigen Grundriss auf. Die Straßen sind im Gitternetz organisiert, wobei zwei Hauptstraßen normalerweise besonders hervorgehoben sind; sie bilden ein Achsenkreuz, wobei die Nord-Süd-Achse als cardo, die Ost-West-Achse als decumanus bezeichnet wird. An der Kreuzung der Achsen im Zentrum der Stadt befindet sich das Forum mit den wichtigsten öffentlichen Gebäuden. Die Städte sind von Wall und Graben umgeben und öffnen sich über vier Tore, wo die Topografie dies erlaubt, zum Umland. Außerhalb der Stadt liegen meist die Gräberfelder, die Nekropolis. Politisch waren die Römerstädte Verwaltungs- und kultische Zentren von größere Bezirke umfassenden civitates. Mit der Krise des Römischen [<<25] Reiches im 3. Jh. begannen sich die Strukturen, die die Städte mit ihrem Umland und dem Reich insgesamt verbanden, aufzulösen: Angesichts der militärischen Bedrohung durch die Germanen mussten die Städte befestigt und ummauert werden, wodurch sich das äußere Erscheinungsbild radikal veränderte; die Stadt erhielt Burgcharakter. Wegen der deshalb steigenden Steuerbelastung der führenden Schichten von Grundbesitzern, die bis dahin in der Stadt wohnten, verließen diese die Städte und etablierten sich in quasi-autarken römischen villas auf dem Land, was natürlich die ökonomische Leistungsfähigkeit der verbliebenen Stadtbevölkerung schwächte.
Der Bischof wurde dann für die Kontinuität des Städtischen über das Ende des Römischen Reichs hinaus ein wichtiger Faktor: Im Zuge der Christianisierung des Römischen Reiches seit dem frühen 4. Jahrhundert wurden Bischofssitze gegründet; diese wurden jeweils in einer civitas angesiedelt, folgten also der Organisationsstruktur des Römischen Reiches. Bereits unter Kaiser Konstantin erhielten Bischöfe auch weltliche Machtbefugnisse, etwa in der zivilen Gerichtsbarkeit. Als mit der Völkerwanderung und dem Fall Roms Ende des 5. Jahrhunderts die Zentralgewalt kollabierte, verblieb der Bischof häufig als der tatsächliche Herr der civitas.
Städte waren also in den sich seit dem 6. Jahrhundert bildenden germanischen Reichen sehr deutlich in ihrer Ausdehnung und Bevölkerung geschrumpft, sie hatten Festungscharakter, waren wegen des Exodus der Großgrundbesitzer vom Umland isoliert. Sie hatten aber mit dem Bischof eine lokale Herrschaftsfigur, die einerseits letzte Reste staatlicher Autorität repräsentierte, andererseits die Kontinuität mit der römischen Kulturtradition sicherstellte. Diese Kontinuität prägte sich innerhalb Europas sehr unterschiedlich aus.2 Während im Gebiet östlich des Rheines, das von der römischen Kultur nur partiell und kurzfristig erfasst worden war, keine direkte Kontinuität festgestellt werden kann, lassen sich in den Gebieten, wo Romanen auch nach der Völkerwanderung den überwiegenden Anteil der Bevölkerung stellten, etwa in Spanien, Süd- und Südwestfrankreich und Italien sehr große Kontinuitätslinien konstatieren; hier behielt etwa auch der Adel häufig seinen Wohnsitz in den Städten bei. Das vielfältigste Bild präsentiert sich in einer Zone zwischen Seine und Rhein, die einerseits tief von der römischen Kultur geprägt war, andererseits aber doch starken Erschütterungen durch die Völkerwanderung ausgesetzt war. Während im Norden dieser Zone große Römerstädte wie Colonia Trajana (heute Xanten) um die Mitte des 5. Jh. vollständig verlassen waren, zeigt Köln eine recht deutliche Siedlungskontinuität, etwa im Standort des Doms an der Stelle der spätantiken Bischofskirche, [<<26] in der Weiternutzung des römischen Statthalterpalastes am Rhein als Residenz der Merowinger oder im Straßenraster. In anderen Fällen knüpften frühmittelalterliche Siedlungen zwar an Römerstädte an, aber nicht an deren zentrale Teile, sondern häufig in Vorstädten oder in der Nähe von Grabkirchen auf den ehemaligen Gräberfeldern wie etwa in Bonn, Mainz und Speyer.
Insgesamt resultierte der Untergang des Römischen Reiches auch nördlich der Alpen nicht in einem vollständigen Kollaps städtischer Zivilisation; für Gallien im 6. Jahrhundert sind quellenmäßig eine nach wie vor dichte städtische Besiedlung, starke Befestigung von Städten wie etwa Dijon und ein ausgeprägter Binnenhandel mit Waren aller Art als klare Indikatoren städtischer Wirtschaft nachgewiesen.3 Die Kirche bildete vielfach die Kontinuitätsbrücke: „Im Schatten der Kirche“, so die Historikerin Edith Ennen, „retten sich städtische Lebensgewohnheiten ins Mittelalter.“4 Allerdings ist generell eine starke Schrumpfung der Bevölkerung vieler Städte zu konstatieren; der städtische Standort der Gewerbe wurde teilweise aufgegeben. Die Römerstraßen verloren erheblich an Bedeutung, weil sie nicht mehr unterhalten und gesichert werden konnten, der Handel wandte sich vermehrt den Flüssen zu. Insgesamt fehlte eine starke und an der Aufrechterhaltung der Infrastruktur interessierte Zentralgewalt, die Verkehrskreise und Beziehungen zwischen den Städten reduzierten sich erheblich. Waren die Städte als Mittelpunkte der civitates im Römischen Reich die entscheidenden Schaltstellen politischer und wirtschaftlicher Macht gewesen, so wurden sie im Karolingerreich zu Inseln in einer ländlich gewordenen Umwelt. Die städtische Lebensform war nicht mehr länger die Lebensform schlechthin, das Land, seine Klöster, seine Herrensitze hatten Eigenbedeutung, strebten nach Selbstversorgung jenseits städtischer Märkte.