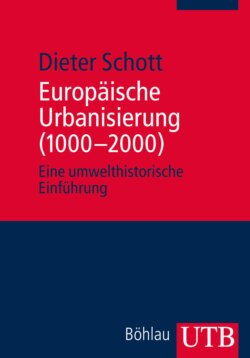Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 14
2.4 Kerne frühmittelalterlicher Stadtentwicklungen: Von der „Burg“ zur „Stadt“
ОглавлениеFassen wir diese Befunde zusammen: Kerne frühmittelalterlicher Stadtentwicklungen waren häufig befestigte Sitze weltlicher oder geistlicher Herrscher. Der Bedarf dieser Herren, einschließlich ihres Gefolges, an Nahrung, vor allem aber auch an anderen [<<36] Waren, zog Handwerker und Händler an. Markt, Zoll und Münze waren dann Zubehör einer solchen städtischen Siedlung. Eine die ganze Siedlung umfassende Mauer war dagegen häufig erst eine Leistung der Stadtgemeinde im Hochmittelalter, nach 1100.
Diese befestigten Herrensitze wurden in den Quellen meist „Burg“ genannt. Peter Johanek betont, dass das lateinische civitas im Kloster Fulda Anfang des 9. Jahrhunderts mit „Burg“ übersetzt wurde. Und als Bonifatius 742 dem Papst die Gründung der mitteldeutschen Bistümer Würzburg, Buraburg und Erzburg meldete, und dabei die lateinischen Begriffe castellum, oppidum und urbs auf einer Ebene nebeneinander stellte, war der Papst besorgt und insistierte, dass Bischofssitze nicht in Dörfern oder unbedeutenden Städten errichtet werden dürften, sondern nur in einer civitas im antiken Sinne.18 “Burg“ war, so schließt Johanek aus den Quellen, im 9. und 10. Jahrhundert eben nicht identisch mit dem Bild der Höhen- oder Wasserburg, das automatisch – wenn heute der Begriff fällt – vor unserem geistigen Auge aufzieht. Diese Art von Burgen wurde erst seit dem 12. Jahrhundert typisch und monopolisierten den Begriff „Burg“ danach zunehmend.19 Im 9.-11. Jahrhundert bezeichnete „Burg“ vielmehr, so Johanek, eine „Großsiedlung mit differenzierter Bevölkerung, die durch besondere Rechtsverhältnisse charakterisiert waren.“20 So wird Köln im Annolied um 1100 als die sconistir burge (= schönste Stadt) bezeichnet; Köln war damals und für längere Zeit die weitaus größte Stadt in Deutschland mit deutlich über 10.000 Einwohnern. „Burg“ wurde auch für die deutschen Namen alter Römerstädte verwendet, etwa Augs-burg, Regens-burg oder Straß-burg.21 Die Stadtvorstellung des frühen und hohen Mittelalters war also weitgehend reduziert auf die Schutzfunktion; „Stadt“ wurde um 1000 wahrgenommen als „Groß-Burg“.22 Diese Fokussierung auf die Schutzfunktion der [<<37] Stadt, ihre Wehrhaftigkeit, kam auch in der bildlichen Darstellung zum Ausdruck, etwa im Stadtsiegel, auf dem bevorzugt Tore, Mauern, und Zinnen die Stadt in ihrer Gesamtheit repräsentieren.23
Diese Burg-Städte sind, so Mitterauer, „[t]opographisch … durch einen Dualismus von Befestigungsanlagen und Marktort charakterisiert, zu denen mitunter als drittes gesondertes Siedlungselement auch noch ein Königshof als Herrschaftssitz hinzutritt. Die miteinander korrespondierenden Siedlungsteile sind in ihrer Lage von unterschiedlichen Standortfaktoren bestimmt. Die Fluchtburg bedarf eines natürlichen Schutzes, die Händlerniederlassung hingegen schließt sich eher einem geeigneten Landeplatz oder einem günstigen Flussübergang an, wobei freilich der Handelsverkehr als das mobilere Element der Befestigungsanlage folgt.“24
Diese civitates, diese „Stadt-Burgen“ der karolingischen Zeit hatten von vornherein ohne besondere Privilegierung das Recht, Märkte abzuhalten. Marktrechtsverleihung durch Privileg, wie es die fränkischen Könige seit dem 9. Jahrhundert praktizierten, wurde meist eher geistlichen Immunitätsherren gewährt, nicht Städten. Die Einfälle der Sarazenen, Normannen und Ungarn in der zweiten Hälfte des 9. und der ersten Hälfte des 10. Jh. brachten dann erneut eine einschneidende Veränderung: Die Mauern und Befestigungen mussten verstärkt und erneuert werden. Häufig waren die Grafen dazu nicht in der Lage, dagegen erwies sich der Bischof vielerorts als der wirkliche Schutzherr der Stadtbevölkerung. Damit setzte an vielen Orten ein Prozess der Übertragung politischer Rechte für das Stadtgebiet an den Bischof ein, der letztlich zu einer Verdrängung des Grafen aus der Stadt und zu einer scharfen Stadt-Land-Trennung auf politischer und gerichtlicher Ebene führen sollte.25 Parallel dazu verschob sich der Begriff “Burg“ in seiner Bedeutung zunehmend auf den Herrschaftssitz des Hochadels, häufig auch topografisch hervorgehoben auf einer Anhöhe. Diese Herrensitze entwickelten sich allerdings seit dem 12. Jh. meist nicht mehr zu Städten, sie wiesen nur rudimentären Gewerbebesatz zur Versorgung der Burginsassen auf. [<<38]
Zeitlich vollzog sich dieser Bedeutungswandel im Verlauf des 12. Jahrhunderts: Wurde Freiburg (im Breisgau) noch um 1120 als klassischer Burgmarkt gegründet, so erhielt Ende des 12. Jh. eine städtische Neugründung in der oberösterreichischen Riedmark dagegen den Namen Freistadt.26
Wir haben in diesem Kapitel erläutert, wie die Wieder- oder Neugründung von städtischen Siedlungen von einer gewissen Dynamisierung des mittelalterlichen, primär auf Selbstversorgung orientierten Wirtschaftssystems und dem Prozess des Landesausbaus abhängig war. Als Faktoren für die Entstehung von Städten kamen meist Herrschaftsfunktionen, geografische Gunstfaktoren und die Etablierung eines Marktes zusammen. Wesentlicher, auch namensprägender Bedeutungskern dieser Städte war ihre Befestigung, ihre Charakteristik als „Großburg“, die zwar militärisch und rechtlich vom Umland getrennt war, zugleich aber für ihre Versorgung auf dieses Umland angewiesen war und für das Umland vielfältige zentralörtliche Funktionen leistete.27 [<<39]
1 Vgl. Michael Mitterauer: Von der antiken zur mittelalterlichen Stadt, in: Ders.: Markt und Stadt im Mittelalter, Stuttgart 1980, S. 52–67; Frank G. Hirschmann: Die Stadt im Mittelalter, München 2009, S. 1–2.
2 Vgl. Edith Ennen: Die europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen 41987, S. 31–44.
3 Vgl. Ennen, Stadt, S. 35.
4 Ennen, Stadt, S. 47.
5 Vgl. Friedrich-Wilhelm Henning: Das vorindustrielle Deutschland 800 bis 1800, Paderborn 31977, S. 19; Angabe nach Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand der Bevölkerung am 31.12.2011. Die Zahl bezieht sich auf die Bundesrepublik im Gebietsstand nach 1990, <http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab1.asp>, Zugriff: am 04.04.2013.
6 Vgl. Hartmut Boockmann: Einführung in die Geschichte des Mittelalters, München 82007, S. 31–34; Werner Rösener: Bauern im Mittelalter, München 41993, S. 14.
7 Vgl. Henning, Deutschland, S. 48.
8 Vgl. Henning, Deutschland, S. 49.
9 Vgl. Rösner, Bauern, S. 129–133.
10 Vgl. Friedrich-Wilhelm Henning: Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland, Band 1: 800 bis 1750, Paderborn u. a. 1979, S. 78–80. Aktuell (2012) liegt das Saat-Ernte-Verhältnis in Mitteleuropa etwa 10-mal so hoch, bei 1:25–30, <http://u01151612502.user.hosting-agency.de/malexwiki/index.php/Getreide>; Zugriff: am 06.04.2013.
11 Vgl. Felicitas Schmieder: Die mittelalterliche Stadt, Darmstadt 2005, S. 23.
12 Vgl. Richard Bauer: Geschichte Münchens, Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 22008, S. 15–17.
13 Vgl. Hansjörg Küster: Versorgung und Entsorgung in der mittelalterlichen Stadt, in: Konrad Spindler (Hrsg.): Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa. Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Befunde, Klagenfurt 1998, S. 311–325, hier S. 316.
14 Vgl. Rolf Sprandel: Art. „Stapel“, in: Lexikon des Mittelalters 8 (2003), S. 59–60.
15 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 27 u. 35; Hirschmann, Stadt im Mittelalter, S. 14; Stefan Petersen: Stadtentstehung im Schatten der Kirche. Bischof und Stadt in Hildesheim bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts, in: Uwe Grieme (Hrsg.): Bischof und Bürger. Herrschaftsbeziehungen in den Kathedralstädten des Hoch- und Spätmittelalters, Göttingen 2004, S. 143–163.
16 Schmieder, Stadt, S. 25.
17 Vgl. Elsbet Orth: Frankfurt am Main im Früh- und Hochmittelalter, in: Frankfurter Historische Kommission (Hrsg.): Frankfurt am Main – Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen, Sigmaringen 1991, S. 9–52, hier bes. S. 32–50; Felicitas Schmieder: Von der Furt der Franken zur Pfalz der Staufer, in: Lothar Gall (Hrsg.): FFM 1200. Tradition und Perspektiven einer Stadt, Sigmaringen 1994, S. 29–42, hier S. 29 f.; Schmieder, Stadt, S. 25 f. Thomas Bauer: Wahl und Krönung, in: Lothar Gall (Hrsg.): FFM 1200. Traditionen und Perspektiven einer Stadt , Sigmaringen 1994, S. 153–182, hier 153.
18 Peter Johanek: Die Mauer und die heiligen Stadtvorstellungen im Mittelalter, in: Wolfgang Behringer/Bernd Roeck (Hrsg.): Das Bild der Stadt in der Neuzeit. 1400–1800, München 1999, S. 26–38.
19 Vgl. zur neueren Burgenforschung Georg U. Grossmann/Hans Ottomeyer (Hrsg.): Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen „Burg und Herrschaft“ und „Mythos Burg“ Berlin/Nürnberg/Dresden 2010.
20 Johanek, Mauer, S. 26.
21 Johanek, Mauer, S. 28.
22 Vgl. auch Michael Mitterauer: Von der antiken zur mittelalterlichen Stadt, in: Ders.: Markt und Stadt im Mittelalter, Stuttgart 1980, S. 52–67, S. 61 f., der allerdings betont, dass der Dualismus von Burg und Stadt nicht überall in Europa sich in dieser Weise herausgebildet hat, etwa kaum in Osteuropa, wo mit dem Suffix „grod“ oder „grad“ (=Burg) die Burgfunktion für Stadt im Namen erhalten blieb.
23 Vgl. Wolfgang Behringer: Die Entwicklung der bildlichen Repräsentation der Stadt im europäischen Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, in: Michael Jansen/Jochen Hoock/Jörg Jarnut (Hrsg.): Städtische Formen und Macht. Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung IAS, Aachen 1994, S. 97–107; Peter Johanek: Bild und Wahrnehmung der Stadt. Annäherungen an ein Forschungsproblem, in: Ders. (Hrsg.): Bild und Wahrnehmung der Stadt, Köln/Weimar 2012, S. 1–23, hier 11.
24 Mitterauer, Von der antiken Stadt, S. 61.
25 Vgl. Mitterauer, Von der antiken Stadt, S. 64.
26 Mitterauer, Von der antiken Stadt, S. 64.
27 Vgl. Michael Mitterauer: Städte als Zentren im mittelalterlichen Europa, in: Peter Feldbauer/Wolfgang Schwentker/Ders. (Hrsg.): Die vormoderne Stadt. Asien und Europa im Vergleich, Wien/München 2002, S. 60–78, hier S. 61.