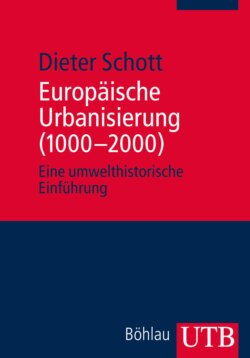Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 24
4.2.3 Die Substitution von lokalen Waldbeständen
ОглавлениеIn vielen Städten, die lokal zu wenig Wald hatten, aber an flößbaren Flüssen lagen, wurde die Flößerei systematisch weiter entwickelt.24 Flussnahe Areale wie etwa in München die spätere Kohleninsel an der Isar, heute Standort des Deutschen Museums, dienten als Floßlände und Holzlagerplatz, in städtischen Straßen- und Gewannnamen wie „Holzmarkt“, „Holzhof“ etc. sind solche früheren Nutzungen noch aufg [<<74] ehoben. Stadtferne Waldbestände, jenseits der intensiver für den Nahrungsbedarf eines Marktzentrums genutzten „Thünenschen Zonen“, wurden zunehmend durch Wege und Triftbäche erschlossen, um die Transportkosten so gering wie möglich zu halten. Bauholz, bei dem höhere Qualitätsanforderungen im Hinblick auf Festigkeit und Geradheit gestellt wurden, wurde häufig aus größeren Entfernungen, meist auf dem Wasserweg beschafft. Amsterdam, im Morast gelegen, wurde in der frühen Neuzeit zu erheblichen Teilen auf Pfählen errichtet, die im Schwarzwald geschlagen worden waren und auf dem Rhein in großen Floßverbünden nach Holland geflößt wurden.25 Köln, am Rhein als Arterie des Holztransports gelegen, versuchte im 15. Jahrhundert sein Stapelrecht, das Recht, die Stadt passierende Kaufleute zu zwingen, ihre Waren auf dem städtischen Markt drei Tage anzubieten, auch auf das rheinabwärts verschiffte Holz auszudehnen, um damit seine Holzversorgung zu verbessern. Große städtische Zentren in Meeresnähe, wie die Städte Flanderns, die kaum Wälder in ihrem Umland hatten, wurden schon im 13. Jahrhundert mit Brennholz aus der Grafschaft Kent in Südost-England, seit dem späten Mittelalter per Schiff mit (Bau-) Holz aus dem Ostseeraum, aus Norwegen etc. beliefert.26 Auch dies lässt sich als Beleg für die Netzwerk-Theorie, als Hinweis auf die Existenz weitreichender Handelsbeziehungen nicht nur für Luxuswaren, sondern auch für Massengüter wie Holz bereits um 1300 verstehen. Das Weichselgebiet wurde hinsichtlich der Holzversorgung zum Hinterland von Brügge und Gent, Danzig zur gateway city zur Erschließung der Ressourcen des polnischen Hinterlandes.27 Auch Hamburg entwickelte sich zum Holzhandelsplatz für elbabwärts geflößte Hölzer: Die Stadt versorgte nicht nur ihren eigenen Bedarf mit Holz aus den böhmischen Wäldern, sondern exportierte auch erhebliche Mengen, Holz war im 15. Jahrhundert nach Getreide und Bier das drittwichtigste Exportgut des Hamburger Hafens; das meiste Holz ging in die Niederlande.28
Holzversorgung war also ein zentrales Element städtischer Versorgungspolitik; sie motivierte den Erwerb von Wäldern im Umland der Städte, förderte, wo dies möglich war, das Engagement für eine städtische Territorialpolitik, wie sie uns besonders deutlich im Falle von Nürnberg und Ulm entgegentritt.29 Eine Alternative zur politischen [<<75] oder polizeilichen Sicherung der Versorgung war die Etablierung fester und langfristiger Handelsbeziehungen zu Holzlieferanten in größerer Entfernung. Dennoch waren große Städte wie Paris stets bestrebt, Wälder in unmittelbarer Nähe gewissermaßen als Reserve für den Fall der Unterbrechung weiträumiger Versorgungsbeziehungen kontrollieren zu können.
Die Substitution von Holz als Brennholz durch andere Brennstoffe fand in Kontinentaleuropa, im Unterschied zu England, kaum auf breiterer Front statt. Zwar hatte der Abbau von Steinkohlen bei Lüttich um 1200 begonnen, aber für die Grundversorgung spielte Steinkohle zunächst kaum eine Rolle. In den Niederlanden und in Norddeutschland wurde für massiv Holz verbrauchende Gewerbe, wie an einzelnen Orten die Salzsiederei, Torf verbrannt. Ende des 15. Jahrhunderts taucht in rheinischen Zollrechnungen auch bereits Kohle auf, die offenbar aus Gruben an der Saar und der Ruhr in die Niederlande transportiert wurde.30