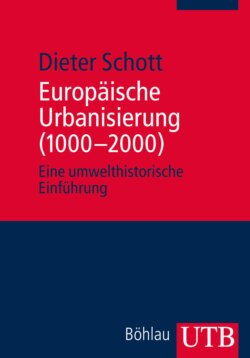Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 23
4.2.2 Anfänge einer Waldschutz-Politik
ОглавлениеIm ausgehenden 13. und frühen 14. Jahrhundert, generell eine Periode sich zuspitzender Ressourcenknappheit, erkannten Zeitgenossen zunehmend die Gefahren einer Übernutzung von Wäldern. Insbesondere die Reichsstadt Nürnberg entwickelte im späten 13. Jahrhundert eine systematische Waldschutzpolitik: In der ältesten Waldordnung von 1294 wurden die Reichswälder vor den Toren Nürnbergs gegen Raubbau geschützt. Wenige Jahre später befahl Kaiser Heinrich VII. 1309 den Nürnbergern, den während der letzten 50 Jahre stark geschädigten Reichswald „wieder zu Wald zu machen.“13 Der Nürnberger Rat bemühte sich daraufhin, die Oberhoheit über die Reichswälder an sich zu ziehen und verfolgte eine Politik, die stark Holz verbrauchende Gewerbe wie Kohlenmeiler, Glas- und Schmelzhütten oder Hammerwerke aus den Reichswäldern verdrängte. Nürnberg, um 1400 eine Stadt mit 5600 Einwohnern, hatte zugleich durch das stark ausgeprägte Metallgewerbe einen besonders hohen Holzbedarf für den Betrieb der Schmieden und Schmelzen. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts monopolisierte der Nürnberger Rat jedoch die Reichswälder im Wesentlichen für die Nutzung als Bau- und Brennstoff für lokalen Bedarf; die Saigerhüttenindustrie mit ihrem extrem hohen Holzkohlebedarf wurde systematisch aus den Reichswäldern an erznahe Standorte Mitteldeutschlands abgedrängt. Beispielhaft für einen planmäßigen Umgang mit der Ressource Wald wurde dann insbesondere die Nadelholzsaat, die vom prominenten Ratsherrn und Handelsherrn Peter Stromer (damals häufig auch “Stromeir“ geschrieben) [<<71] 1368 erstmals erfolgreich praktiziert wurde. In der Folgezeit wurde der ursprüngliche Laubholzwald der Reichswälder, in denen die Eichen die Hauptbaumart gestellt hatten, systematisch und langfristig in einen Nadelholzwald umgeformt, in dem Kiefern dominierten. Dieser tief greifende Landschafts- und Vegetationswandel war keinesfalls nur ein Resultat der mageren Böden, sondern resultierte aus ökonomischen Präferenzen: Kiefern und andere Nadelbäume wachsen deutlich schneller als Laubhölzer, schon nach einer Umtriebszeit von 60–80 Jahren kann hier „geerntet“ werden. Die Nürnberger Reichswälder stellen daher den ersten „Kulturwald“ im deutschsprachigen Raum dar im Sinne einer durch menschliche Planung erfolgten Aufforstung und Artenselektion.14 Auch der heute noch dominierende Besatz des Nordschwarzwalds mit Fichten ist nicht der Überlegenheit dieser Baumart für die bodenmäßigen und klimatischen Standortbedingungen geschuldet, sondern Resultat „anthropogener Waldzerstörungen“ seit dem Spätmittelalter.15 Insgesamt sind heute nur noch sehr wenige Wälder in Mitteleuropa Urwälder in dem Sinne, dass ihre aktuelle Artenzusammensetzung dem Zustand vor Beginn einer systematischen Waldwirtschaft entspricht. Veränderte sich – u. a. durch menschliche Steuerung – die Zusammensetzung von Baumarten, so konnte auch die Funktion des Waldes als Nährwald erheblich beeinträchtigt werden. So schränkte das Verschwinden der Weißtanne die Waldbienenzucht und damit die Honigproduktion an waldnahen Standorten erheblich ein.16 Die Nadelholz-Saat entwickelte sich zum Exportschlager: Bereits Ende des 14. Jahrhunderts wurde sie in großem Umfang für den Frankfurter Stadtwald angewandt, Nürnberg lieferte denn auch in der Folgezeit immer wieder Nadelholzsamen, häufig zusammen mit Fachleuten, nach Frankfurt wie auch in andere Städte.17
In Erfurt, ebenfalls eine im Spätmittelalter rasch wachsende Stadt, wird 1359 erstmals von einer Schlageinteilung im Stadtwald berichtet.18 Bestimmte Waldabschnitte, sogenannte Schläge, wurden zu festgelegten Zeiten zum Fällen freigegeben, gleichzeitig andere gesperrt, um eine Regeneration und Verjüngung des Waldes zu ermöglichen. Diese Praxis setzte sich dann mit der obrigkeitlichen Forstwissenschaft der frühen [<<72] Neuzeit allgemein durch. Ihre physische Manifestation, die Einteilung des Waldes in durch meist orthogonal angelegte Waldwege und physische Barrieren klar abgegrenzte Bezirke, bestimmt noch heute das Gesicht unserer Wälder.19
Insgesamt bewirkte die Angst vor einer drohenden Verknappung der Ressource Wald vielfältige Vorsorgemaßnahmen der Städte für die Wälder, deren Nutzung sie beeinflussen konnten. Generell hing die Regelungsdichte in Bezug auf den Stadtwald, wie Ernst Schubert konstatiert, von der Größe einer Stadt, ihrer Transportsituation und dem Grad ihrer Holzabhängigkeit ab. Nürnbergs Vorreiterrolle resultierte auch aus dem Umstand, dass die Stadt sich eben nicht auf dem Wasserweg preisgünstig mit den erforderlichen Holzmengen versorgen konnte; sparsame und langfristig angelegte Ressourcenbewirtschaftung wurde daher besonders wichtig. Waldpolitik zielte auf den Schutz bestimmter Waldteile und bedeutete häufig auch die Einschränkung der Allmend-Nutzungen des Waldes seitens der städtischen Einwohner, die traditionell im Stadtwald Holz lesen und auch Bau- und Werkholz in gewissem Rahmen entnehmen durften. Vom Rat eingesetzte Waldknechte beaufsichtigten und regulierten nunmehr die Waldnutzung der Städter.
Waldschutzpolitik konnte allerdings nur greifen, wenn überhaupt nennenswerte Waldbestände in der Nähe einer Stadt vorhanden waren. Für viele Städte traf dies nicht (mehr) zu, und von daher entwickelten sich seit dem Spätmittelalter zunehmend räumlich ausgreifende Handelsbeziehungen zwischen Waldgebieten und Holzbedarfsgebieten. London, mit rund 80.000 Einwohner um 1300 eine der größten europäischen Städte nördlich der Alpen, wurde mit Brennholz aus einem umfangreichen Einzugsgebiet längs der Themse und auf beiden Seiten der Themse-Mündung versorgt, rund 160 km von Henley am Oberlauf der Themse bis Foulness und Margate an der Themse-Mündung; diese Zone war aber nur rund 27 km tief auf beiden Seiten, weil der Landtransport sonst zu teuer geworden wäre.20 Die Fläche, die für die Sicherung von Londons Brennholzbedarf um 1300 erforderlich war, lag bei rund 29.000 ha, der „Holz-Fußabdruck“ umfasste also rund das Hundertfache der städtischen Gemarkungsfläche! In diesem Gebiet wurden Wälder speziell für die Brennholzbedürfnisse der Hauptstadt bewirtschaftet. Niedrige, schnell nachwachsende Laubbäume wurden in vergleichsweise kurzen Zyklen „geerntet“.21 Während London die Ausrichtung der Region auf [<<73] seine Holzbedürfnisse primär marktgesteuert erreichen konnte, bietet die Salzstadt Lüneburg ein Beispiel für eine dediziert politische Sicherung von Versorgungsgebieten: Nachdem die lokalen Waldbestände auf den Flächen, die jetzt die Lüneburger Heide bilden, abgeholzt waren, baute Lüneburg mit erheblichem Aufwand Floßkanäle, um Brennholz aus den mecklenburgischen Wäldern herbeizuschaffen. Trotzdem gelang es Lüneburg langfristig nicht, den Niedergang der Stadt aufzuhalten; das in Lüneburg raffinierte Salz war zu teuer, um die Konkurrenz mit anderen Salzstädten und deren günstigeren Produktionsbedingungen bestehen zu können.22 Aber auch in Fällen wie etwa Lübeck, das dank eines Barbarossa-Privilegs von 1188 durchaus substanzielle Wälder in der Nähe besaß, schloss der Rat im Sinne einer Diversifizierung und wohl auch zur Schonung der eigenen Bestände Verträge mit regionalen Adligen über befristete Waldnutzungen zur Gewinnung von Bauholz. Solche Verträge bezifferten die Zahl der Bäume, die innerhalb des Vertragszeitraums entnommen werden durften, meist ging es um hochstämmige Eichen. Lübeck nutzte auch seine verkehrsgünstige Lage und seine weit gespannten Handelsbeziehungen, um Bauholz aus dem Ostseeraum zu beziehen; Danzig fungierte hier als wichtiger Umschlagplatz.23