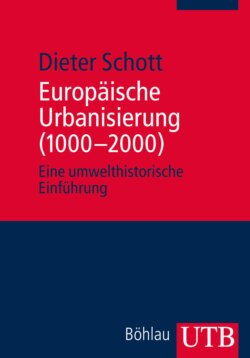Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 25
4.3 Getreideversorgung
ОглавлениеDas entscheidende Gut für die physische Reproduktion mittelalterlicher und auch noch frühneuzeitlicher Städte war die Versorgung mit Getreide. Der Anteil des Getreides am täglichen Kalorienbedarf der Menschen lag im Mittelalter bei 60–75 %, die in Form von Brot, Mus oder Bier konsumiert wurde. Pro Stadtbewohner war ein jährlicher Bedarf von 1,65 Quartern (1 Quarter = 290 l) an Getreide anzusetzen.31 Der räumliche Einzugsbereich, aus dem die Getreideversorgung stattfinden konnte, war durch transportwirtschaftliche Logiken begrenzt: Bei Entfernungen über 35–40 km über Land, 1–2 Tagesreisen, näherte sich der Futterbedarf der Zugtiere dem Kaloriengehalt des transportierten Getreides an, energetisch war der Landtransport über weitere Entfernungen also ein Nullsummenspiel oder gar ein Verlustgeschäft. Nur in Hungersnöten können wir weiträumigeren Landtransport von Getreide nachweisen, etwa von Thüringen nach Köln.32 [<<76]
Betrachten wir das Beispiel London etwas näher: Rund drei Viertel der Anbaufläche der zehn Grafschaften um London wurde für Getreideanbau genutzt. Die Nachfrage Londons beeinflusste die Wahl der angebauten Getreidearten tief greifend, gelegentlich sogar im Widerspruch zur spezifischen Eignung von Böden. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatte sich ein homogener Getreidemarkt in Südengland herausgebildet, der wesentlich durch den Bedarf Londons gesteuert wurde; auf diesem Markt bewegten sich die Preise in der Regel synchron und in die gleiche Richtung. Offenbar hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon ein einigermaßen effizientes Handelsnetzwerk etabliert; lokale Marktstädtchen dienten als Sammelpunkte für Getreide, das von dort weiter in die Hauptstadt verschickt wurde.33 Auch auf dem Kontinent repräsentierten „… [K]leinere Städte und Märkte […] wichtige Scharniere in einem größeren Handelsnetzwerk und trugen erheblich zur Senkung der Kosten des Handels und somit zu einer kommerziellen Verdichtung bei.“34 Der südenglische Getreidemarkt schloss auch Flandern, die Picardie, die Normandie und andere küstennahe Gebiete des Kontinents mit ein. Als Folge des Bevölkerungskollaps nach der Pest Mitte des 14. Jahrhunderts schrumpfte Londons Getreideversorgungsbereich erheblich.35
Für Flandern und die Niederlande, eine der im Spätmittelalter am stärksten urbanisierten Regionen Europas nördlich der Alpen, zeigt Richard Unger, dass angesichts der nach der Pest zunächst deutlich zurückgegangenen Bevölkerung die Getreideversorgung weitgehend aus der Region erfolgen konnte.36 Gleichwohl wurde die bereits vor 1350 in Ansätzen etablierte Fernversorgung mit Getreide nicht aufgegeben. Schon vor der Pest kamen substanzielle Getreidelieferungen aus der Altmark an der Elbe über [<<77] Hamburg in die flandrischen Städte.37 Als gegen Ende des 15. Jahrhunderts klassische Versorgungsregionen für Flandern und die Niederlande, etwa die Normandie, wegen wieder wachsender Bevölkerung nur geringere Überschüsse für die Bedarfsgebiete Flanderns zur Verfügung hatten, setzte in größerem Maße der Getreidefernhandel nach Flandern wieder ein: Bezugsquellen waren zum einen Süddeutschland im Einzugsbereich schiffbarer Flüsse, zum anderen Getreideanbaugebiete mit Wasseranschluss im Einzugsgebiet der Ostsee. Dass der flämische Getreidemarkt so weit reichte, zeigt ein nachweisbarer Gleichklang in der Fluktuation der Getreidepreise zwischen den großen Getreidemärkten in Frankfurt, Straßburg, Rostock und den südenglischen und den niederländischen Städten, wobei in den Niederlanden die Preisausschläge stets am höchsten waren. Unger interpretiert diese Preismuster als Anzeichen einer regen Spekulation mit Getreide in den niederländischen Städten, wobei die Spekulation auch vielfältige Maßnahmen der Städte zur Regulierung des Getreidehandels provozierte. Andererseits akzeptierten Stadtregierungen die Notwendigkeit hoher Getreidepreise, denn dadurch strömte auch in Mangeljahren ausreichend Nachschub in die Niederlande. Ein weiteres Motiv für Entwicklung eines Getreidefernhandels, obwohl die weitere Region die Versorgung hätte eigentlich sichern können, waren die Handelsinteressen: Flandern baute in erheblichem Umfang Handelsbeziehungen in die Ostsee hinein auf. Dort traten zunehmend an die Stelle der Hanse flandrische Schiffe, die Waren etwa aus dem Mittelmeerraum in die Ostsee brachten; diese benötigten auch eine Rückfracht, z. B. Getreide. Das „Getreidehinterland“ von Flandern und den Niederlanden war also im Spätmittelalter in der Masse immer noch einigermaßen regional begrenzt, aber die Konturen eines international integrierten Getreidemarkts zeichneten sich bereits im späten 15. Jahrhundert ab; im 17. Jahrhundert sollte der Getreideimport aus der Ostsee nicht nur für die Niederlande, sondern auch für Westeuropa, vorübergehend auch für Südeuropa in größerem Umfang dann sehr wichtig werden.38
Jenseits der hochgradig verstädterten Landschaften versorgten sich jedoch die meisten europäischen Städte aus einem weiter gezogenen Umland; für Köln (40.000 Einwohner im späten 15. Jahrhundert), das über ein sehr fruchtbares Umland links des Rheins verfügte, reichte ein Gebiet von 1800 qkm zur Versorgung mit Getreide, während Nürnberg (28.000 Einwohner Ende 15. Jahrhundert) mit wesentlich schlechteren Böden im nahen Umland ein Getreideversorgungsgebiet von rund 5000 km² [<<78] benötigte.39 Im Spätmittelalter setzte an vielen Orten auch schon die planmäßige Bevorratung von Getreide seitens der städtischen Obrigkeit, der Bau von Kornspeichern und Magazinen ein. Neben gewissen Anfängen im 14. Jahrhundert wurden besonders seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als die Bevölkerung wieder deutlich wuchs, Kornspeicher errichtet, die dann in Mangeljahren zum Ausgleich, vor allem zur Versorgung der ärmeren Stadtbevölkerung, dienten. In Hungerkrisen war die städtische Bevölkerung in der Regel „erheblich besser gestellt als die Landbewohner.“40