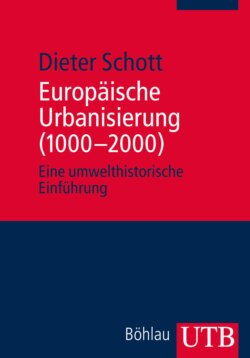Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 16
3.1.2 Von der Stadt zur Kommune: Der Emanzipationsprozess der Städter
ОглавлениеFrüh- und hochmittelalterliche Städte waren in der Regel – wie in Kap. 2 (S. 25) an Hildesheim gezeigt – zunächst keine einheitlichen Siedlungen. Häufig finden wir eine Reihe topografisch wie auch sozial und funktional unterschiedlicher Siedlungskerne, die jeweils für sich befestigt waren. Die Bewohner dieser Siedlungskerne lebten unter jeweils anderen Rechtsverhältnissen und bildeten noch keine einheitliche politische Gemeinschaft; sie waren vielfach persönlich noch unfrei und standen in unterschiedlichen Dienst- und Abhängigkeitsverhältnissen von ihren jeweiligen Grundherren. Gesamteuropäisch können wir jedoch seit dem frühen 11. Jahrhundert eine graduelle und allmähliche Emanzipation der Städter beobachten, eine Einebnung der rechtlichen Unterschiede zwischen den Stadtbewohnern, die Bildung von Vereinigungen der Bürger, die in unterschiedlichem Ausmaß ihre Belange selbst verwalteten. Dieser Aspekt, die Selbstverwaltung der Städte – meist durch ihre Oberschicht – ist im Kern das, was Max Weber in universalgeschichtlicher Perspektive als Sonderweg der „okzidentalen Stadt“ beschrieben hat. Weber identifizierte in seinem Fragment gebliebenen und erst posthum veröffentlichten Werk „Die Stadt“ die freiwillige Vereinigung der Bürger europäischer Städte im Schwur (coniuratio) als zentrales konstitutives Merkmal der “okzidentalen“ (europäischen) Stadt im Unterschied zu den als Herrschaftspunkte fungierenden außereuropäischen Städten, wie sie uns etwa im Vorderen Orient oder in China begegnen.6
Dieser säkulare Prozess der Emanzipation der Städter vollzog sich seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im Kontext der Kirchenreform und des Reformpapsttums. Kernpunkt der Kritik der Reformer war die Verweltlichung der Kirche, gefordert wurde eine Rückbesinnung der Kirche auf sich selbst. Dazu dienten die Durchsetzung des Zölibats und eine schärfere Interpretation der Simonie, des Ämterkaufs. Kirchliche und weltliche Macht waren um 1000 intensiv miteinander verflochten; hohe Positionen in der Kirche, vor allem die Ämter von Bischöfen, waren zugleich einträgliche Pfründe und weltliche Machtpositionen. Zur Sicherung ihrer Herrschaft stützten sich [<<43] insbesondere die ottonischen Könige des 10./11. Jahrhundert im Reich vorrangig auf die Bischöfe. Die Kirchenreform sah diese Verflechtung extrem kritisch: Wenn Laien, wie etwa der König, an der Besetzung kirchlicher Ämter beteiligt waren, galt dies als Simonie und damit verloren das Sakrament, das der Bischof spendete, aber auch die Weihe von Priestern durch den Bischof ihre Gültigkeit.7
Die Kirchenreform untergrub die Autorität der geistlichen und weltlichen Fürsten und trug zu einer Politisierung breiter Schichten bei.8 Im Kontext dieser Debatten sind erste Ansätze kommunaler Emanzipationsbewegungen zu interpretieren, die sich in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts in Norditalien, insbesondere in Mailand zeigten. Mailand, seit 374 Bischofsstadt, war im Hoch- und Spätmittelalter die größte Stadt Italiens und hatte religiöse und wirtschaftliche Zentralfunktionen. In den Jahren 1035–37 erhoben sich bischöfliche Lehnsleute zusammen mit nichtadeligen städtischen Grundbesitzern gegen den Bischof und dessen Versuch, den Adel umfassender zu beherrschen. In diesem Aufstand taucht bereits die Institution der coniuratio, der Schwureinung auf, die die Aufständischen untereinander schlossen. Nach dem Sieg über den Bischof wandte sich aber das Volk, vor allem die nichtadeligen städtischen Führungsschichten, gegen die adligen Vasallen, die jetzt Mailand beherrschten; sie bildeten eine politische Gemeinde und schworen sich gegenseitig einen Verpflichtungseid. Christliche Vorstellungen brüderlicher Gleichheit prägten diese Kommunenbildung. Spätestens mit der pataria seit den 1050er-Jahren spielten die Kirchenreform und der Kampf gegen die Simonie eine wichtige Rolle. Das Ergebnis langwieriger Kämpfe war letztlich eine deutliche Beschneidung der Befugnisse des Erzbischofs als Stadtherr; eine neue städtische Führungsschicht setzte 1097 eine konsularische Stadtverfassung ein und verdrängte den Erzbischof 1127 dann auch formell aus der Rolle des Stadtherrn. Mittelfristig profilierte sich nicht nur Mailand, sondern ganz Oberitalien als „Innovationsregion“, wo sich „… ein neues innovatives Modell zur Ausgestaltung kommunaler Freiheit, zur sozialen Differenzierung aufsteigender gesellschaftlicher Gruppen, zur Gestaltung des ökonomischen Wandels …“ formierte.9 [<<44]
Ähnliche Bewegungen setzten in der Periode ab etwa 1070 auch nördlich der Alpen, in Nordfrankreich, Flandern und dem Rheinland ein. Der intensive Handelsverkehr zwischen den oberitalienischen und den rheinischen und flandrischen Städten legt es nahe, dass man nördlich der Alpen von den norditalienischen Kommunenbildungen wusste. Politischer Kontext der städtischen Emanzipationsbewegungen war der Investiturstreit zwischen den Königen des Heiligen Römischen Reiches und dem Papst, wie er sich vornehmlich in der Periode 1056–1125 entwickelte.10 Investitur meint die Einweisung eines Geistlichen in sein Amt durch den zuständigen Oberen, die Verleihung der Symbole weltlicher (Temporalia = Ring) und geistlicher (Spiritualia = Bischofsstab) Gewalt. Unter den Ottonen war es üblich geworden, Vertraute und Verwandte des Königs als Bischöfe einzusetzen. Bischöfe im Heiligen Römischen Reich waren gleichzeitig Geistliche und Träger von Reichslehen, sie erhielten vom König gräfliche Hoheitsrechte wie das Befestigungsrecht für Städte oder die Hochgerichtsbarkeit über sie. Diese Doppelrolle der Reichsbischöfe war nach der neuen Lehre der Kirchenreform nicht mehr zulässig, denn sie bedeutete ja die wesentliche Mitwirkung weltlicher Gewalten an der Besetzung der Bischofssitze, erfüllte somit den Tatbestand der Simonie. Resultat der Kritik war ein jahrzehntelanger Machtkampf zwischen Papst und Kaiser um das Primat. Papst Gregor VII. (Papst 1073–1085) engagierte sich besonders für die Durchsetzung der Kirchenreform, woraus sich ein heftiger Konflikt mit dem deutschen König Heinrich IV. ergab. Dessen dramatischer Höhepunkt bildete der bekannte Gang nach Canossa (1077), bei dem der mit Exkommunikation belegte König um Lösung des Banns seitens des Papstes ersuchte. Für den Emanzipationsprozess der Städter eröffnete der Investiturstreit neue Handlungsspielräume, weil die konkurrierenden Akteure Kaiser und Papst jeweils nach Bündnispartnern für ihre Sache suchten und dafür bereit waren, den Städten weitreichende Zugeständnisse in der Verleihung von Selbstverwaltungsrechten zu machen.
Das Beispiel Worms zeigt, wie die Einwohner der Stadt in diesem Kontext lernten, als politische Gemeinschaft zu agieren und zu “Bürgern“ wurden. Die Bewohner von Worms – wie auch aller anderen Städte – waren im 11. Jahrhundert in mehrere Personenverbände (familia) gegliedert, die jeweils einem Grundherrn untertan waren, aber unterschiedliche Rechtsstellungen hatten. Diese familiae waren keine Blutsverwandten, sondern bildeten eine Rechtsgenossenschaft. Die familia war insbesondere wichtig im Hinblick auf Heirats- und Vererbungsbestimmungen. Wer einen Partner außerhalb der familia heiraten wollte, brauchte die Zustimmung des Grundherrn. [<<45] Wenn etwa der Mann „ausheiratete“, wurde das Buteil fällig, eine Art Zwangsabgabe von bis zu zwei Drittel des Besitzes. Starb ein Mitglied einer familia, so musste eine „Todfallabgabe“ zugunsten des Grundherrn geleistet werden, was bei wohlhabenderen Kaufleuten existenzbedrohend wirken konnte.11 Stadtherr von Worms war der Bischof, der zuvor die Familie der Salier aus der Position der Grafenrechte in Worms verdrängt und diese selbst übernommen hatte. 1073 war König Heinrich IV., selbst Salier, in einer extrem schwierigen Lage: Vom Papst drohte die Exkommunikation und der sächsische Adel hatte sich gegen ihn erhoben. Als Heinrich nun vor den Toren von Worms stand, erhoben sich die Wormser, verjagten die Soldaten des Bischofs und auch ihn selbst und öffneten dem Kaiser die Tore zu einem prunkvollen Einzug. Der Zeitgenosse Lambert von Hersfeld schildert den Konflikt so:
Als der König kam, zogen sie (die Bürger von Worms) ihm bewaffnet und gerüstet entgegen, nicht um ihm Gewalt anzutun, sondern damit er beim Anblick ihrer Anzahl, ihrer Waffen und der Zahl ihrer bewaffneten Jugend in seiner schwierigen Lage sofort erkenne, wie viel Hoffnung er in sie setzen dürfe. Sie versprachen ihm bereitwillig ihre Hilfe, leisteten ihm einen Eid, boten ihm an, zu den Kosten des Krieges jeder einzelne aus seinem eigenen Vermögen beizutragen, und bekräftigten, dass sie Zeit ihres Lebens eifrig für seine Ehre kämpfen wollten. So besaß der König eine wohlbefestigte Stadt und machte sie zur Zentrale seines Krieges, zur Festung seiner Herrschaft und auch – was immer geschehen möge – zur sicheren Zuflucht, weil sie durch die Zahl ihrer Bürger und die Festigkeit ihrer Mauern uneinnehmbar war und durch die Fruchtbarkeit der Umgebung sehr reich und mit allem, was im Krieg von Nutzen zu sein pflegt, gut ausgestattet.12
Die Wormser schlossen sich in dieser Situation also zu gemeinschaftlichem Handeln zusammen, sie agierten politisch und militärisch gegen ihren Stadtherrn und boten dem König ihre Loyalität an. Im Gegenzug befreite der König die Wormser in einer Urkunde von 1074 von allen Reichszöllen, stärkte also ihre Position im Fernhandel. Die Wormser Urkunde von 1074 ist das erste Privileg, das ein König für die Bürger einer Stadt als Gemeinschaft ausstellte.13 [<<46]
Eine ähnliche Situation entstand 1074 in Köln, wo es ebenfalls nach Konflikten zwischen dem Erzbischof und städtischen Eliten zu einem Bündnis zwischen den führenden Kaufleuten Kölns und dem König kam. Anfang des 12. Jahrhunderts zeigten sich Elemente einer kommunalen Selbstverwaltung in Form eines Schöffenkollegiums. Heinrich IV. gibt viri illustri, die die Kommune repräsentierten, den Auftrag, die Stadtbefestigung zu erweitern, was normalerweise ein stadtherrliches, also dem Bischof zustehendes Recht war.
Insgesamt gewährten Stadtherren oder auch der König den aufbegehrenden Städtern in dieser Periode Rechte, die ihre Gemeinschaft stärkten. Die hofrechtlichen Vorbehaltsrechte der Grundherren, wie etwa Ehebeschränkungen zwischen den Stadtbewohnern, wurden aufgehoben, die Zahlung vom Buteil entfiel, wenn Mitglieder einer familia außerhalb dieser heirateten. Auch die existenzgefährdende Todfallabgabe wurde nicht mehr fällig. Die rechtliche Situation der Städter verbesserte sich damit erheblich, sie erhielten einen freieren Status.
Die Rechtssicherheit der Stadtbürger stieg auch bedeutend durch das sogenannte ius de non evocandi, den Schutz davor, vor ein auswärtiges Gericht geladen zu werden oder von auswärtigen Steuereinnehmern belangt zu werden. Erzbischof Albert von Mainz gewährte dieses Recht den Mainzer Bürgern 1119 aus Dank dafür, dass sie ihn aus der Gefangenschaft von Heinrich V. befreit hatten. Felicitas Schmieder hält zu diesem Prozess fest: „Sukzessive verschwanden alle möglichen Merkmale von Unfreiheit, schließlich sogar der Kopfzins. Stattdessen begann die Stadtgemeinschaft, die das Recht und die Freiheit hatte, nach eigenem Gutdünken intern umzulegen, kollektiv Abgaben zu leisten. […] Aus den hofrechtlich gebundenen Angehörigen der Speyrer, Wormser und Mainzer familiae wurde – […] – ganz allmählich eine nach außen und innen handlungsfähige und handlungsberechtigte Stadtgemeinde mit freien Bürgern und schließlich neuem, für sie alle gültigen Bürgerrecht.“14 Franz Irsigler hält übergreifend fest: „Um 1100 beginnt eine neue Epoche in der Geschichte des europäischen Städtewesens.“15
Zusammengefasst entstand in solchen Aktionen der Bürgergemeinden und der Gewährung von Privilegien und Freiheiten im 12. Jahrhundert in den rheinischen Städten, die hier als „Innovationsregion“ fungierten16, ein Katalog dessen, was eine [<<47] freie und selbstbestimmte Stadtgemeinde ausmachen sollte. Persönliche Freiheitsrechte und kollektive Mitbestimmungsrechte griffen hier vielfach ineinander, die den einzelnen Städten erteilten Privilegien wurden ausführlicher, nahmen aufeinander, auf andere Städte und deren Rechte Bezug. Insgesamt war der Wunsch nach „Freiheit“ ein starkes Motiv kommunaler Bewegungen in ganz Europa. Otto von Freising, der Geschichtsschreiber des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa, kommentierte, durchaus kritisch, die kommunale Entwicklung Oberitaliens um 1154 mit den Worten „Denn sie lieben die Freiheit so sehr …“.17 Allerdings war der Prozess zur politischen Freiheit und Selbstständigkeit langwierig und mit zahlreichen Rückschlägen und Rücknahmen bereits erteilter Privilegien verbunden. Erst mit dem Rheinischen Städtebund von 1254/1257 hatte sich die politische Autonomie der Städte in den wichtigeren rheinischen Städten durchgesetzt; die Städte zeigten sich nunmehr „… als selbstständige[r] politische[r] Kraft neben geistlichen und weltlichen Fürsten und Adel.“18 Die plakative Feststellung „Stadtluft macht frei“ ist in dieser Formulierung zwar eine moderne Prägung, der Wortlaut lässt sich in mittelalterlichen Quellen so nicht finden, aber ihr Bedeutungskern trifft im 12. Jahrhundert in wachsendem Maße zu. Der Aufenthalt in einer Stadt „über Jahr und Tag“ verlieh den ehemaligen Hörigen persönliche Freiheit; dies wurde immer breiter in Stadtrechten zum anerkannten Rechtsprinzip.
Was gehörte zu einer solchen, sich selbst regierenden Stadt? Die Stadt bildete zunehmend eigene Organe aus, die sich meist von Gerichten, von der Funktion von Schöffen als Gerichtsbeisitzern, herleiteten. So etablierte sich ein Rat, ein Stadtvogt übte stadtherrliche Rechte aus, aber die Stadtgemeinde erkämpfte sich häufig das Recht auf Wahl dieses Vogtes. Häufig blieben die Beziehungen zwischen Stadtherr und Stadtgemeinde über viele Jahrzehnte konfliktträchtig, sie veränderten sich im Zusammenhang mit der gesamtpolitischen Lage und der Stärke oder Schwäche des jeweiligen Stadtherrn. Die skizzierten Emanzipationskämpfe betrafen ältere etablierte Städte, vor allem Bischofsstädte entlang des Rheins, in denen sich die wirtschaftlich mächtig gewordene städtische Oberschicht gegen ihre Stadtherren auflehnte und Selbstverwaltungsrechte – letztlich erfolgreich – einforderte. Im Zuge dieser sich teilweise über mehrere Jahrzehnte hinziehenden Auseinandersetzungen wuchs die zuvor stark gegliederte und rechtlich differenzierte Einwohnerschaft zu einer Gemeinschaft rechtlich freier und sich selbst regierender und richtender Bürger zusammen, die [<<48] Kommunen werden in den Quellen als „… eigenständige Rechtspersonen mit einem je nach Situation unter Umständen beträchtlichen Handlungsspielraum erkennbar …“.19 In zahlreichen Fällen gelang es Städten nach teilweise langen Auseinandersetzungen, die Herrschaft ihres unmittelbaren Stadtherren, sei es der Bischof oder ein Landesherr, abzuschütteln; sie unterstanden danach nur noch direkt dem König und Kaiser und wurden „Reichsstädte“ genannt. Einige der ehemaligen Bischofsstädte, die im Prinzip einen ähnlichen Status weitgehender Autonomie genossen, wurden als „Freie Städte“ bezeichnet. Im späten 13. Jahrhundert gab es insgesamt gut 100 Reichsstädte.20