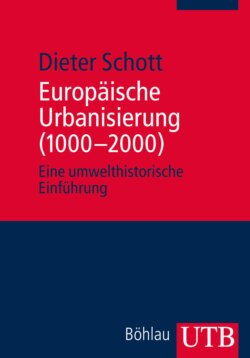Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 15
3 Die Herausbildung der europäischen Städtelandschaft im Mittelalter 3.1 Stadtblüte im Hochmittelalter (1100–1300) 3.1.1 Wirtschaftliche und demografische Veränderungen 11. – 14. Jh.
ОглавлениеFür die rasante Entwicklung von Städten in Europa seit dem späten 11. Jahrhundert war das europaweite Bevölkerungswachstum bis ins 14. Jahrhundert grundlegend. Es gibt zwar keine verlässlichen Zahlen, aber im Hinblick auf die Gesamttendenz ist die Forschung sich weitgehend einig: Nach einem massiven Rückgang in der Periode nach dem Untergang des Römischen Reichs, die Rede ist von rund einem Drittel bis ins 8. Jahrhundert, begann im 9. Jahrhundert ein Wiederanstieg, der bis zum Jahr 1000 zu einer Verdoppelung führt. Anschließend, bis ins frühe 14. Jahrhundert, dürfte sich die Bevölkerung nochmals verdoppelt haben. Cipolla gibt, bei großen Unsicherheiten, für die britischen Inseln ein Wachstum von 2 Mio. (1000) auf 5 Mio. (1300), für Frankreich von 5 auf 15 Mio., für Deutschland von 5 auf 12 Mio. an.1 Die Dynamisierung der Landwirtschaft setzte sich fort, das Tempo des Landesausbaus beschleunigte sich nach 1150 noch deutlich. Zudem begann auch der Prozess der Ostkolonisation, der planmäßigen Ansiedlung deutscher Bauern, Handwerker und Kaufleute in den Regionen östlich der Elbe, häufig verbunden mit Gründungen neuer Marktstädte und militärischer Stützpunkte. Auf den britischen Inseln vollzog sich in dieser Phase die Eroberung und Kolonisierung von Wales und Irland durch die normannischen Könige, wobei die Gründung von Städten als Herrschaftsmittelpunkte zentrale Bedeutung hatte.2 [<<41]
Begünstigt wurde die Transformation der Landwirtschaft durch eine vorteilhafte Veränderung des Klimas: Im Zeitraum von 1000–1250 waren die Sommertemperaturen im Durchschnitt 1 Grad Celsius wärmer als in der Periode 800–1000, außerdem war der Niederschlag deutlich, etwa um 10 % reduziert.3 Diese Klimaveränderung, die Klimahistoriker sprechen vom „mittelalterlichen Wärmeoptimum“, ermöglichte die Kultivierung von sogenannten Grenzböden, etwa in Mittelgebirgen, die in der vorhergegangenen Kaltperiode wegen zu kurzer Vegetationsperioden und zu niedrigen Temperaturen nicht mit Ackerbau bewirtschaftet werden konnten. Außerdem erlaubten die milderen klimatischen Bedingungen, Pflanzen an Standorten zu kultivieren, wo sie im Zuge der klimatischen Abkühlung seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr gediehen. So gab es etwa ausgedehnte Weinberge in Südengland und auch in Norddeutschland weit über die gegenwärtigen Standorte hinaus.4
Zum demografischen Wachstum trug auch bei, dass Europa in dieser Periode von größeren Pestwellen oder anderen Epidemien weitgehend verschont blieb. Parallel zum Landesausbau durch Rodungen und Urbarmachung sumpfigen, unwegsamen Geländes steigerten technologische Veränderungen die Produktivität der Landwirtschaft und schufen Spielräume für ein Wachstum der Zahl nicht-agrarischer Produzenten. Mit Hilfe des Kummet konnte die Kraft der Pferde besser genutzt werden, der Wendepflug mit Streichbrett ermöglichte tieferes Pflügen und eine bessere Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Dreschflegel, Wassermühlen und Windmühlen wirkten arbeitssparend und ermöglichten den Bauern, ihre „freie“ Arbeitszeit im Winter etwa für die Textilproduktion einzusetzen.5
Weil mehr Menschen von den Überschüssen der agrarischen Produktion leben konnten, schuf das wirtschaftliche und demografische Wachstum günstige Rahmenbedingungen für das Wachstum von Städten bzw. die Gründung neuer Städte. [<<42]