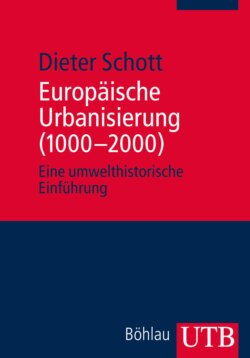Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 22
4.2.1 Die Veränderung des Waldes im Zuge des Landesausbaus
ОглавлениеDie langfristige Expansion der mittelalterlichen Gesellschaft nach 1000 hatte durch Rodungen im Zuge des Landesausbaus die zusammenhängenden großen Waldgebiete des Frühmittelalters zu Fleckenteppichen gemacht. Seit dem frühen 11. Jahrhundert [<<69] waren auf dem Gebiet des späteren Deutschlands 10 Millionen Hektar Wald verloren gegangen, nur noch ein Drittel der nutzbaren Bodenfläche war bewaldet. Zur Sicherung der Ernährung der bis ins 14. Jahrhundert wachsenden Bevölkerung war der Wald auch in Mittelgebirgslagen gerodet worden. Zunehmende Erosion auf Hanglagen und häufigere Überschwemmungen, weil das Wasserrückhaltepotenzial der Wälder nicht mehr so wirksam war, waren ökologische Folgen dieser Landschaftsveränderung.9 Bezeichnenderweise entstanden die Namen für die großen Waldgebiete der Mittelgebirge – Odenwald, Schwarzwald, Bayerischer Wald – erst im Zusammenhang der Binnenkolonisation des 12. Jahrhunderts; nur im Zuge der großen Rodungen wurden die Wälder als abgrenzbare Gebiete wahrnehmbar.10
Die intensive stadtnahe Waldnutzung hatte den Wald aufgelichtet und in seinem Charakter verändert. Bäume wurden nicht wie heute bodennah, sondern in 1,50–2,00 m Höhe gefällt. Diese belassenen Stöcke trieben wieder neue, natürlich weniger mächtige und im bodennahen Bereich gebogene Schösslinge aus, und diese Stöcke wurden in Zeiträumen von 10–20 Jahren erneut geschlagen. Der Wald erhielt durch diese Art der Bewirtschaftung eine andere Prägung, wurde erheblich lichter und auch deutlich niedriger, die Forstwissenschaft spricht von Plenter-, Nieder- oder Mittelwald. Diese Plenterwirtschaft veränderte auch die Häufigkeit der Baumarten: Buchen, auf vielen Standorten in Mitteleuropa eigentlich die von den natürlichen Bedingungen her dominante Baumart, vertrugen diesen häufigen Einschlag nicht; an ihrer Stelle entwickelten sich Hainbuchen, Birken und Haselbüsche. Weil wegen dieser Waldbewirtschaftung eine dichte und lückenlose Baumkrone häufig nicht vorhanden war, drang mehr Licht auf den Waldboden, was eine nennenswerte, die Waldweide ermöglichende Bodenvegetation förderte. Andererseits erschwerte die Weidenutzung durch Vieh die natürliche Regeneration des Waldes, weil die nachwachsenden Jungbäume durch Verbiss geschädigt wurden und so kaum mehr gerade und hochstämmige Bäume austreiben konnten. Dagegen half die Schweinemast im Wald der natürlichen Verjüngung, weil die Schweine beim Wühlen im Waldboden, die Eichelsamen tiefer ins Erdreich brachten und damit deren Keimung beförderten.11 [<<70]
Städte erhielten häufig im Rahmen von Gründungsprivilegien oder späteren Privilegierungen Nutzungsrechte an nahe gelegenen Waldungen, die dann in den Quellen als „Stadtwald“ oder „Ratswald“ bezeichnet wurden. Diese Privilegien umfassten meist nicht nur Holznutzungsrechte, sondern auch andere, auf den Wald bezogene Rechte wie Schweinemast, Beerenlese bis hin zur Nutzung von Bodenschätzen unter dem Waldboden. Diese Waldrechte waren teilweise „fester Bestandteil der Stadtrechte“.12