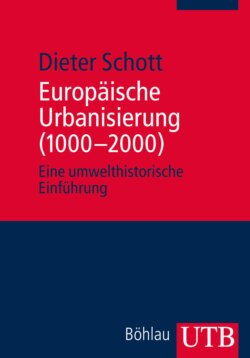Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 20
4 Stadt-Umland-Hinterland: Die Versorgungskreise der mittelalterlichen Stadt 4.1 Das Umland ernährt die Stadt, aber wo ist das Umland?
ОглавлениеWachstum und Bestand einer mittelalterlichen Stadt standen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Möglichkeiten, den Aufwand an Transportenergie für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen zu minimieren und die Nutzung der vorhandenen Energiequellen zu optimieren.1
Mit dieser thesenhaften Zuspitzung bringt Franz Irsigler die Bedeutung gesicherter Nahrungs- und Rohstoffversorgung aus dem Umland einer Stadt sowie die dafür zentrale Rolle des Transports auf den Punkt. Das Umland einer Stadt war von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit einer Stadt, sich mit den für den gesellschaftlichen Stoffwechsel entscheidenden inputs zu versorgen, also insbesondere mit Nahrungsmitteln, Wasser und Energie. Im Folgenden soll nun zunächst die bis heute wichtige Standorttheorie landwirtschaftlicher Produktion von Johann Heinrich von Thünen vorgestellt und daran anschließend an einigen prägnanten Beispielen aufgezeigt werden, wie sich das reale Versorgungs-Umland im Hinblick auf die idealtypischen Modellvorstellungen ausprägte.
In seiner Schrift „Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie“, veröffentlicht 1826, entwickelte der preußische Ökonom Johann Heinrich von Thünen eine Standorttheorie landwirtschaftlicher Produktion: Seine Frage war, an welchen Standorten, in welcher Entfernung von einem großen (städtischen) Markt sich der Anbau welcher Produkte am meisten lohnte. [<<65]
Abb 6a und b Die Thünenschen Ringe Schema A stellt das Idealmodell dar, ohne jede landschaftliche Variation, Schema B ist eine Adaption an eine Landschaft mit einem schiffbaren Fluss
Thünen legte als Modellannahme A eine homogene und flache Landschaft mit Böden gleicher Güte zugrunde. Es gebe weder topografische Hindernisse wie Gebirge noch Gunstfaktoren, die Transport nennenswert verbilligten wie Flüsse. Unter diesen Rahmenbedingungen, wo allein die Transportkosten als mit der Entfernung variabler Faktor eine Rolle spielen, kam Thünen zu der Annahme, dass sich um eine Stadt ringförmige Zonen je spezifischer landwirtschaftlicher Produktionen entwickeln. Die Nutzung der einzelnen Zonen hängt vor allem davon ab, wie verderblich das entsprechende Gut ist und wie viel Transport es im Hinblick auf Verderblichkeit und Wert verträgt. In der Tendenz nehme die Intensität der Bodennutzung, d. h. der Einsatz von Arbeit und Kapital pro Flächeneinheit, nach außen kontinuierlich ab. Nach Thünen ist eine Stadt (Stern innerhalb des Kreises “freie Wirtschaft“) zunächst mit einem Gürtel von Gärtnern umgeben, die den städtischen Markt mit frischem Obst und Gemüse, [<<66] mit Heu, Kartoffeln und Rüben versorgen. Teil der “freien Wirtschaft“ ist auch eine Zone der Milchwirtschaft, die Milch und Butter, also ebenfalls rasch verderbliche Güter produziert. Darauf folgt eine forstwirtschaftliche Zone, die – wegen der hohen Transportkosten – vor allem auf die Belieferung der Stadt mit Brennholz ausgerichtet ist. Die folgende Zone („Landwirtschaft:Fruchtwechselwirtschaft“) ist besonders der Getreideproduktion im Rahmen einer Fruchtwechselwirtschaft gewidmet, in der darauf folgenden Zone („Koppelwirtschaft“) wird verbesserte Dreifelderwirtschaft praktiziert, weiter entfernt von der Stadt herrscht extensive Dreifelderwirtschaft vor. Noch weiter von der Stadt entfernt findet man Zonen für Weidewirtschaft und für Bauholzproduktion. Beide Nutzungsformen vertragen eine größere Entfernung vom Konsumzentrum, weil die Masttiere selbst zur Stadt getrieben werden, oder – bei Schafen – ihre Wolle örtlich gewonnen und zur Stadt gebracht wird. Höherwertiges Bauholz verträgt wegen des höheren auf dem städtischen Markt erzielbaren Preises längeren Transport. Die wesentliche Variable ist eine von innen nach außen abnehmende Intensität der Bodennutzung: Pro Flächeneinheit wird auf marktnahen Flächen erheblich mehr Arbeit, aber auch Kapital eingesetzt und dadurch auch erheblich höhere Erlöse erzielt.
Wie Schema II zeigt, sind die geografischen Bedingungen von Schema I tatsächlich kaum gegeben; Berge und Hügel erschweren, Flüsse, die zum Markt führen, erleichtern Transport in sehr erheblicher Weise. In Schema II zeigen sich die Zonen daher nicht ringförmig um die Stadt, sondern bandförmig auf beiden Ufern des Flusses, der die Zugänglichkeit zum städtischen Markt wesentlich verbessert. Zudem ist die Bodenfruchtbarkeit wie auch die Bebaubarkeit von Böden keineswegs gleichförmig und homogen, sondern variiert zwischen guten und schlechten Böden. Von daher weist das reale Versorgungsumland von Städten erhebliche Abweichungen vom Thünenschen Modell der konzentrischen Ringe auf. Dennoch zeigt sich in vielen Fällen, dass die Versorgungszonen zwar nicht in idealtypischer Ringform vorliegen, aber die reale Abfolge der verschiedenen Nutzungsformen mit wachsender Entfernung vom städtischen Marktzentrum durchaus prinzipiell dem Thünenschen Modell entspricht. Daher spielt das Thünensche Modell als heuristische Grundannahme in Forschungsarbeiten, die sich mit der räumlichen Struktur städtischer Versorgung befassen, nach wie vor eine wichtige Rolle.2 [<<67]