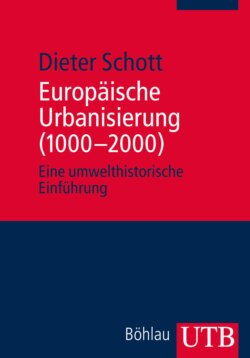Читать книгу Europäische Urbanisierung (1000-2000) - Dieter Schott - Страница 19
3.2.2 Modelle zur Erklärung des europäischen Städtesystems
ОглавлениеWie lässt sich die empirisch beobachtete Struktur des europäischen Städtesystems nun auf einer Modell-Ebene fassen? Ein bis heute wichtiger Ansatz zur Systematisierung der Verteilung von Städten und Orten unterschiedlicher Größe im Raum ist die Theorie der zentralen Orte, formuliert vom Geografen Walter Christaller.36 Christaller untersuchte um 1930 die Stadtstruktur Süddeutschlands in ihrer historischen Genese und identifizierte dabei ein hierarchisch gestuftes System zentraler Orte, wobei sich die Hierarchiestufe der jeweiligen Siedlung daraus ergab, welche Güter und Dienstleistungen jeweils angeboten wurden. Christaller ging davon aus, dass Güter und Dienstleistungen unterschiedliche Reichweiten haben: Je seltener ein Produkt nachgefragt wird, umso größer muss das Absatzgebiet sein, damit das Angebot wirtschaftlich erbracht [<<58] werden kann. Während die Produkte der Bäcker täglich und fast von jedermann nachgefragt werden, ist die Nachfrage nach Schmuck sehr viel geringer; Juweliere benötigen daher ein deutlich größeres Einzugsgebiet als Bäcker, sie werden meist nur in größeren Siedlungen anzutreffen sein.
Abb 5 Modell der zentralen Orte nach Christaller [<<59]
Um zufällige Einflüsse auszuschließen, ging Christaller von einem homogenen Raum und entsprechend proportional variablen Transportkosten aus; die Modellannahmen wurden aus der klassischen Ökonomie übernommen (homo oeconomicus, vollkommene Konkurrenz, vollständige Information). Aufgrund dieser Vorannahmen entwickelte Christaller in seinem Modell eine Theorie über die Einzugsbereiche zentraler Orte. Die optimale Versorgung aller Punkte wäre demnach in einem mehrfach geschachtelten Hexagonal-Schema gewährleistet: Christaller identifizierte sechs verschiedene Hierarchieebenen zentraler Orte mit unterschiedlichen Gütern und Reichweiten, die jeweils aufgrund der oberen Grenze der Reichweite in unterschiedlicher Entfernung angeordnet sein müssen.
Der Hauptort der höchsten Stufe A hat in unmittelbarer Nachbarschaft, weil er sämtliche Güter und Dienstleistungen anbietet, nur Orte der niedrigsten Hierarchiestufe F in einer Entfernung von 7 km. Auf einem nächsten Ring, etwa 12 km entfernt, folgen Orte der zweitniedersten Stufe E usw. Je weiter ein Ort vom ‚zentralen Ort‘ (‚A‘) entfernt ist, umso breiter ist das in ihm vorhandene Angebot an Waren und Dienstleistungen, umso höher seine Zentralitätsstufe. Das Zentrale-Orte-Modell war von großer Bedeutung für die Hierarchisierung von Städten in der Raumordnung und Regionalplanung; noch heute stützt sich das Klassifizierungsmodell von Ober-, Mittel- und Unterzentren und die damit verbundene Zuordnung bestimmter Funktionen zu einzelnen Orten auf die Theorie der zentralen Orte von Christaller.37
Im Hinblick auf die historische Herausbildung eines räumlich hierarchisch organisierten Städtesystems geht das Modell im Prinzip davon aus, dass im Rahmen einer zunehmend dichter besiedelten und intensiver kultivierten Landschaft Überschüsse der agrarischen Produktion entstehen. Diese Überschüsse suchen nach Absatz auf Märkten und daraus bildet sich im Wege der Arbeitsteilung und der Notwendigkeit unterschiedlicher Absatzgebiete eine Hierarchie von Städten heraus. Ein solches Modell kann die Entstehung von Markt- und Amtsstädten in einem primär agrarischen Kontext gut erklären, versagt aber im Hinblick auf die weiter oben aufgezeigte bipolare Struktur und Cluster-Bildungen im europäischen Städtesystem. Nach Christaller dürfte es solche räumliche Konzentrationen großer Städte eigentlich nicht geben.
Kritik an Christallers Konzept macht sich einmal an seinen Modellprämissen fest: ‚Nutzen‘ lag für den mittelalterlichen Menschen nicht nur in Geld oder der Ersparnis [<<60] von Zeit und Arbeitskraft, sondern konnte durchaus auch im Besuch heiliger und besonders bedeutsamer Orte liegen. Christallers Konzept beachtet zweitens die Pluralität von Gründungsmotiven von Städten nicht hinreichend. Städte wurden auch aus politisch-militärischen Interessen, etwa zur Sicherung strategisch wichtiger Punkte gegründet; Untertanen wurden durch die Monopolisierung bestimmter wichtiger Dienstleistungen (z. B. Gerichte) an bestimmten Orten genötigt, diese aufzusuchen. Dritter Kritikpunkt ist die Annahme räumlicher Homogenität: Tatsächlich hat die Topografie deutlich verzerrende Wirkung; an einem Bergpass, wo ein Ausweichen auf andere Routen kaum möglich ist, liegen Siedlungen, auch wegen der schwierigeren Wegverhältnisse und niedrigeren Reisegeschwindigkeiten zwangsläufig dichter beisammen als auf einer wenig Hindernisse bietenden Ebene. Die Lage an einem Meereshafen eröffnet potenziell ein sehr viel größeres Versorgungshinterland als ein Standort im Binnenland. Schließlich vernachlässigt das Modell auch den Aspekt, dass Besorgungen in der Regel gekoppelt wurden – auch eine Art der Nutzenmaximierung, sodass Angebote einer zentraleren Hierarchiestufe dann genutzt wurden, wenn aus anderen Gründen dieser Ort ohnehin aufgesucht werden musste.38
Dennoch behält die Theorie der zentralen Orte von Christaller in vielen Fällen beachtliche Erklärungskraft; Paul Hohenberg und Lynn Lees schlagen daher vor, diese Theorie komplementär mit der Netzwerk-Theorie zu verwenden.39 Die Netzwerk-Theorie geht davon aus, dass dem Fernhandel auch über den tiefen Einschnitt des Frühmittelalters eine recht erhebliche Bedeutung zukommt. Städte werden hier nicht als inselartige, allein auf ihr Umland bezogene Sammel- und Verteilerorte verstanden, sondern vielmehr als Glieder in einer großräumlichen, zunehmend ganz Europa übergreifenden Kette von Handels- und Transportbeziehungen, die auch aus den Handelszentren des Nahen Osten gespeist wurden. Diese Glieder sind aber bis zu einem gewissen Grad flexibel und austauschbar; je nach lokaler Lage sucht sich der Handel neue Wege, umgeht Kriegs- und Katastrophengebiete, wertet neue Städte auf und lässt alte Emporien absinken. Dies zeigte sich etwa im Wechsel von der bis ins 11. Jahrhundert für den Handel zwischen Oberitalien und Nordeuropa präferierten Rheinschiene auf die Route durch Frankreich und die Messen der Champagne, von wo aus sich der Handel angesichts der massiven Störung durch den Hundertjährigen Krieg im 14. Jahrhundert wieder stärker nach Deutschland verlagerte.40 Der [<<61] Fernhandel entfaltete somit über als gateway fungierende Städte eine die Zuordnung von Städten zueinander und die Herausbildung eines bipolaren, funktional integrierten Städtesystems insgesamt bestimmende Kraft. Diese Grundstruktur behielt über viele Jahrhunderte, obwohl die Funktion vorrangiger gateway-Städte wechseln konnte, eine bemerkenswerte Kraft. Als prototypische gateway-Stadt für das Mittelalter bieten Hohenberg und Lees Venedig an.
Venedig- die gateway-Stadt
Die Lagunenstadt entwickelte sich von bescheidenen Anfängen seit dem 6. Jh. auf einer Reihe von Inseln vor allem zur Vermittlerin zwischen dem italienischen Festland und dem Oströmischen Reich. Der Raub der angeblichen Reliquien des Heiligen Markus aus Alexandria im frühen 9. Jahrhundert und der Bau einer Kirche zur Verehrung des Heiligen, des Markusdoms, brachten Venedig eine hohe religiöse Attraktivität und eine große Zahl von Pilgern, die die Reliquien des Heiligen Markus verehren wollten. Wirtschaftlich etablierte sich Venedig schon von frühester Zeit an als Handelsstadt, denn angesichts der prekären Lage auf den Inseln, gab es keinerlei Land für den Anbau von Getreide und anderen Lebensmitteln in nächster Nähe. Anbieten konnte man Fische, die in der Lagune reichlich zu fangen waren, sowie Salz, das man in flachen Becken planmäßig aus dem Meerwasser gewann. Die Handelsinteressen Venedigs, die sich rasch bis in das östliche Mittelmeer ausdehnten, wurden durch eine schlagkräftige Kriegsflotte nachdrücklich unterstützt; Venedig, das formell unter der Hoheit von Byzanz stand, erhielt 1082 vom byzantinischen Kaiser Alexios I. Komnenos das Privileg, im ganzen Herrschaftsbereich Ostroms zollfrei Handel treiben zu dürfen. Damit wurde Venedig zur wichtigsten Drehscheibe zwischen Okzident und Orient; Haupthandelsgüter waren neben Fisch und Salz auch Getreide und Holz, Luxuswaren aus dem Orient und Sklaven. Seit dem 11. Jahrhundert baute Venedig ein meerbasiertes Empire von Stützpunkten und befestigten Häfen im östlichen Mittelmeer auf, das zur Absicherung der Handelsrouten diente, nicht – etwa im Unterschied zu den Bestrebungen zahlreicher norditalienischer Städte im Hinblick auf ihr Territorium, – zum Aufbau einer Festlandsmacht. Dieser vor allem maritim bestimmte Herrschaftsbereich wurde stato da mar genannt und in einer Zeremonie jährlich beschworen, in der sich der jeweilige Doge, der aus der Führungsgruppe der Stadt gewählte oberste Repräsentant Venedigs, symbolisch mit dem Meer vermählte.41 [<<62]
Innerhalb der Raumstruktur der Stadt selbst war alles auf die gateway-Funktion und ihre politische Absicherung ausgerichtet, etwa im Canale Grande, der so groß angelegt war, dass Schiffe von 200 Tonnen ihn durchfahren konnten, oder an der Rialto-Brücke, dem kommerziellen Zentrum. Konstitutiv für die Funktionsweise von Venedig als gateway-Stadt war die im Stadtplan ablesbare enge Verbindung von Stadtregierung, Handel und Schifffahrt.42 Der Staat Venedig selbst war Eigentümer der Galeeren der Handels- und Kriegsflotte, regulierte den Schiffsbau, ihre Ausstattung und Fracht, plante die Seereisen. Die Bürger von Venedig mussten Militärdienst als Ruderer leisten. Auch der Handel war hochgradig reguliert, um Konflikte innerhalb des Adels zu vermeiden. Zahlreiche Regeln zur Funktionsweise des Regierungssystems beschränkten die Macht der Dogen und sicherten eine breite Beteiligung der Elite-Familien an der Machtausübung.43 Mithilfe seiner überlegenen Flotte und der Kooperation seiner Kaufleute baute Venedig ein weitreichendes Handelssystem auf, das der Stadt über viele Jahrhunderte Prosperität und Dominanz sicherte. Venezianische Kaufleute übernahmen insbesondere in den östlichen Mittelmeerhäfen Konstantinopel, Jiddah, Alexandria und Acre (Stadt im Norden des heutigen Staates Israel) orientalische Waren (Gewürze, Seide, wertvolle Waffen etc.), die über Karawanen orientalischer Händler aus Indien, Persien und China ans Mittelmeer geschafft worden waren. Im Austausch lieferte Venedig an den Orient Wolle und Wolltuche, Metall, Rohmaterialien wie Teer und Pech, somit Güter, die aus Nordeuropa über die Champagne-Messen nach Venedig gelangt waren. Zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung eroberte Venedig die Kontrolle über das nah gelegene Festland, die terra ferma, etablierte auf dem Festland aber keine weit ausgreifende Territorialmacht.44
Die Autoren Hohenberg/Lees beschreiben nun ihr entwickeltes „Netzwerksystem“ wie folgt: „At the heart of the system is an ‚internationale of cities‘, each determinedly autonomous and more concerned with the world at large than with its own backyard. A single city’s culture, like its population and trade, is apt to be cosmopolitan and varied.”45 Die Autoren schlagen vor, das zentralörtliche Modell und das Netzwerk- [<<64] Modell für die historische Erklärung der Herausbildung spezifischer Städtesysteme anzuwenden: Je nach Periode und geografischer Lage habe das eine oder andere Modell größere Erklärungskraft. Das zentralörtliche Modell betont stärker die Bedeutung der Landwirtschaft und der regionalen Gesellschaft als Basis für eine von unten her sich vollziehende Herausbildung eines regionalen, hierarchisch gegliederten Städtesystems. Das Netzwerk-Modell unterstreicht im Kontrast dazu stärker die Stimuli, die vom Fernhandel über eine Stärkung städtischer Kaufkraft und Nachfrage zur Belebung und Intensivierung der regionalen Landwirtschaft ausgingen, reflektiert die Einbettung von Städten und Regionen in europäische Handelssysteme. Allerdings waren Städte höchst selten nur „zentrale Orte“ oder nur gateways. Auch in gateway cities gab es immer ein Element zentralörtlicher Funktion für das Umland. Umgekehrt bildeten auch die meisten herausgehobenen zentralen Orte jenseits ihrer Zentralfunktion für eine mehr oder weniger klar definierte Region zugleich auch ein Glied in einer Handelskette und wirkten als Teil eines ortsübergreifenden Netzwerkes.46 [<<64]
1 Carlo M. Cipolla: Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000–1700, London 32005, S. 2–3.
2 Vgl. Hans-Werner Goetz: Leben im Mittelalter: vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, München 5. Auflage 1994, S. 20–21; Gerrit Deutschländer: Bevölkerungsentwicklung im Mittelalter, in: Matthias Meinhardt (Hrsg.): Mittelalter, München 2009, S. 17; Peter Clark: European Cities and Towns, 400–2000, Oxford 2009, S. 32; Michael North: Europa expandiert. 1200–1500, Stuttgart 2007, S. 18–22.
3 Vgl. Ian C. Simmons: An Environmental History of Great Britain, Edinburgh 2001, S. 70; Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas. 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2. Erweiterte Auflage 2008, S. 59–60.
4 Vgl. James, A. Galloway: Driven by Drink? Ale Consumption and the Agrarian Economy of the London Region, c. 1300–1400, in: Martha Carlin/Joel T. Rosenthal (Hrsg.): Food and Eating in Medieval Europe, Cambridge 1998, S. 88; Werner Rösener: Bauern im Mittelalter, München 4. Auflage 1991, S. 112.
5 Vgl. Henning, Vorindustrielles Deutschland, S. 53–54.
6 Vgl. Max Weber: Die Stadt. in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 47 (1921), S. 621–772. Aus der umfangreichen Sekundärliteratur dazu vgl. Hinnerk Bruhns/Wilfried Nippel (Hrsg.): Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich, Göttingen 2000; Otto Gerhard Oexle: Max Weber und die okzidentale Stadt, in: Erich Schmidt (Hrsg.): Stadt – Gemeinde – Genossenschaft: Festschrift für Gerhard Dilcher zum 70. Geburtstag, Berlin 2003, S. 375–388; Christian Meier (Hrsg.): Die okzidentale Stadt nach Max Weber: zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter, München 1994 [=Historische Zeitschrift, Beiheft 17].
7 Vgl. Hans-Werner Goetz: Kirchenreform und Investiturstreit: 910–1122, Stuttgart (2. Aufl.) 2008, bes. S. 67–118.
8 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 57.
9 Bernd Schneidmüller: Die Staufer und Italien – oder: drei europäische Innovationsregionen. Ein Schlusswort, in: Ders./Stefan Weinfurter/Alfried Wieczorek (Hrsg.): Verwandlungen des Stauferreichs. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa, Darmstadt 2010, S. 478–486, hier S. 481; vgl. auch Schmieder, Stadt, S. 60.
10 Vgl. Goetz, Kirchenreform, S. 119–184.
11 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 47 u. 75.
12 Lamperti monachi Hersfeldensis Opera. Ed. Oswald Holder-Egger, Hannover 1894 (MGS Scriptores rerum Germanicarum in us. Schol. Editum. 38), S. 169, zit. nach Schmieder, Stadt, S. 69–70.
13 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 70–71.
14 Schmieder, Stadt, 77 u. 78.
15 Franz Irsigler: Über Stadtentwicklung. Beobachtungen am Beispiel von Andres, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 11 (1983), S. 7–19, hier S. 9.
16 Vgl. Schneidmüller, Staufer, S. 481–482.
17 Bischof Otto von Freising und Rahewin: Die Taten Friedrichs, S. 308 f, zit. nach Schulz, Urbanisierung Mitteleuropas, S. 158.
18 Schulz, Urbanisierung Mitteleuropas, S. 163.
19 Hirschmann, Stadt, S. 11.
20 Vgl. Hirschmann, Stadt, S. 32–35.
21 Heinz Stoob: Stadtformen und städtisches Leben im späten Mittelalter, in: Ders. (Hrsg.): Die Stadt. Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter, Köln [u. a.] 1985, S. 151–190, hier S. 151.
22 Vgl. Untermann, Matthias: Archäologie in der Stadt. Zum Dialog der Mittelalterarchäologie mit der südwestdeutschen Stadtgeschichtsforschung. In: Bernhard Kirchgässner/Hans-Peter Becht (Hrsg.): Stadt und Archäologie. Stuttgart 2000, S. 9–44, hier S. 28–32; vgl. auch Hans Schadek/Matthias Untermann: Gründung und Ausbau. Freiburg unter den Herzogen von Zähringen, in: Heiko Haumann/Ders. (Hrsg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 1, Stuttgart 1996, S. 57–119, hier S. 59–62.
23 Rekonstruiertes Freiburger Recht von 1120, zit. nach Schmieder, Stadt, S. 84 f.
24 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 84.
25 Vgl. Schmieder, Stadt, S. 85–86; Jan Gerchow/Hans Schadek: Stadtherr und Kommune. Die Stadt unter den Grafen von Freiburg, in: Heiko Haumann/Ders. (Hrsg.): Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 1, Stuttgart 1996, S. 133–205.
26 Vgl. Hirschmann, Stadt, S. 12–14; Boockmann, Stadt, S. 29.
27 Vgl. Rodekamp, Leipzig, S. 54.
28 Vgl. Volker Rodekamp (Hrsg.): Leipzig original. Bd. 1: Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Völkerschlacht, Altenburg 2006, S. 50–63; Otto Künnemann/Martina Güldemann: Geschichte der Stadt Leipzig, Gudensberg-Gleichen 2. Aufl. 2004, S. 5–21.
29 Vgl. Künnemann/Güldemann, Leipzig, S.16–17.
30 Vgl. Clark, European Cities, S. 34.
31 Vgl. Paul Hohenberg/Lynn H. Lees: The Making of Urban Europe. 1000–1994, Cambridge, MA./London (2. rev. Auflage) 1995, Ch. 2 „Systems of early cities“, S. 47–73.
32 Vgl. Herbert Hassinger: Zur Verkehrsgeschichte der Alpenpässe in der vorindustriellen Zeit, in: VSWG 66 (1979), S. 441–465, hier S. 444–447.
33 Vgl. Nicholas, Urban Europe, S. 13; North, Europa, S. 63; Clark, European Cities, S. 48.
34 Vgl. zu Brügge Girouard, Stadt, S. 85–100; Wim Blockmans: Brügge als europäisches Handelszentrum, in: Valentin Vermeersch (Hrsg.): Brügge und Europa, Antwerpen 1992, S. 41–56; Marc Ryckaert: Brügge als europäischer Hafen, in: Vermeersch, Valentin (Hrsg.): Brügge und Europa, Antwerpen 1992, S. 27–40.
35 Zum Wassersystem Brügges vgl. Girouard, Stadt, S. 90–91; Hubert de Witte: Some Notes on the Infrastructure of Brugge, with the Emphasis on the Water Supply, in: Manfred Gläser (Hrsg.): Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, Bd. IV: Die Infrastruktur, Lübeck 2004, S. 107–115.
36 Vgl. Walter Christaller: Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena 1933.
37 Vgl. Zur aktuellen Bedeutung des Modells Jürgen Holtzan: dtv-Atlas zur Stadt. Von den ersten Gründungen bis zur modernen Stadtplanung, München 1994, S. 58–59; Kersten Krüger: Kreis und Sechseck – die Modelle räumlicher Ordnung von Johann Heinrich von Thünen und Walther Christaller im Vergleich, in: Das Thünensche Erbe im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Tellow 2008, S.77–89; Heineberg, Stadtgeographie, S. 90.
38 Vgl. zur Kritik an Christallers Modell Hohenberg/Lees, Making, S. 58–59.
39 Vgl. Hohenberg/Lees, Making, S. 59–73.
40 Vgl. Hohenberg/Lees, Making, S. 64; Clark, European Cities, S. 47–48.
41 Vgl. Arne Karsten: Geschichte Venedigs, München 2012, bes. S. 28–29; Hohenberg/Lees, Making, S. 66–69; Girouard, Stadt, S. 100–112.
42 Vgl. Hohenberg/Lees, Making, S. 67; Karsten, Geschichte, S. 38–42.
43 Vgl. Hohenberg/Lees, Making, S. 67–69; Girouard, Stadt, S. 101.
44 Vgl. Karsten, Geschichte, S. 40–45.
45 Hohenberg/Lees, Making, S. 70.: „Das Herz des Systems bildete eine ‚Internationale von Städten‘, die jeweils nachdrücklich autonom und mehr mit der großen weiten Welt als mit dem eigenen ‚Hinterhof‘ befasst waren. Die Kultur einer einzelnen solchen Stadt neigt, ebenso wie ihre Bevölkerung und ihre Handelsstruktur dazu, kosmopolitan und vielschichtig zu sein.“ (Übersetzung D. S.)
46 Vgl. Hohenberg/Lees, Making, S. 69–73.