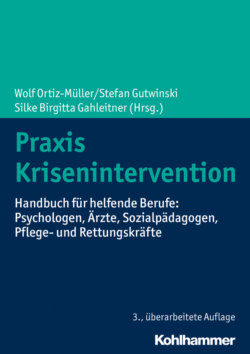Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Die Deutungshoheit des »medizinischen Modells« verliert an Bedeutung
ОглавлениеDer kulturrevolutionäre Zweifel, aus dem die Student*innenbewegung ihre kritische Potenz bezog, sah in dem vorherrschenden Krankheitsbegriff ein Disziplinierungsmittel, mit dem alle Widerstandsformen gegen die Eindimensionalität der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung erstickt werden sollten. Zentral war die »Befreiung« aus dem paradigmatischen Gefängnis des »medizinischen Modells«. Es entstand eine bemerkenswerte Resonanz für die Debatten um Normalität und Abweichung und für »gute Gründe«, in einer »verrückten Gesellschaft« verrückt zu werden. Es gab einen Diskurs zur Überwindung (klein)bürgerlicher Normalitätsgehäuse, und die »Verrückten« wurden als Avantgarde idealisiert, die sich bereits auf eine »Reise« begeben hatten, auf der wir ihnen möglichst bald nachfolgen sollten.
Herbert Marcuse war für die Debatten der damaligen Zeit einer der wichtigsten Ideengeber. Wiederentdeckt wurde damals ein Vortrag von ihm (Marcuse, 1968), in dem er 1956 auf einem Kongress amerikanischer Psychiater*innen die Frage stellte, ob angesichts der Irrationalität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die in Rüstung, Verkehr, Umweltzerstörung und Ausbeutung ein historisch einmaliges Destruktionspotenzial entfalten, die Anpassung daran als Pathologie der Normalität zu bezeichnen wäre und nicht das Verweigern der Anpassung als psychisch krank.
Nur eingebettet in diesen intensiven fachlichen und politischen Kampf um eine angemessene Sicht auf psychosoziales Leid wird verständlich, wie leidenschaftlich die Kontroverse um das »medizinische Modell« geführt wurde (Keupp, 1972, 1979).
Eröffnet wurde diese Kontroverse durch einen Aufsatz, den Thomas S. Szasz 1960 im »American Psychologist«, dem wichtigen Fachorgan der American Psychological Association (APA), dem American Psychologist, publizierte. Szasz, an der State University of New York psychoanalytisch ausgebildeter Psychiater, löste eine intensive Diskussion um das bislang vorherrschende Krankheitsmodell in der Psychopathologie aus. Seine Kritik hatte eine doppelte Zielrichtung: Einerseits bestritt er die Berechtigung, ein biomedizinisches Modell auf das menschliche Handeln zu übertragen. Das sei erkenntnistheoretisch nicht vertretbar, weil es das Handeln biologistisch verkürze. Außerdem sei es ethisch fragwürdig, weil es dem Subjekt die Handlungsfreiheit abspreche. Andererseits machte er das »medizinische Modell« verantwortlich für eine höchst fragwürdige gesellschaftliche Rolle der Psychiatrie, die die Bearbeitung gesellschaftlicher Konflikte und Widersprüche, die seiner Auffassung nach das Leiden der Menschen erzeugten, verhindere. Dadurch übernehme sie die Funktion eines »sozialen Tranquilizers«, der verhindere, dass Konflikte bearbeitet und ausgetragen würden. Insofern leiste sie einen fragwürdigen Beitrag, den gesellschaftlichen Status quo zu sichern.
Diese Doppelbotschaft, erkenntnistheoretisch und herrschaftskritisch zugleich, hat Szasz in den 1960er und 1970er Jahren eine große Resonanz verschafft, zumal er ein Buch nach dem anderen schrieb.1 Sie alle sollten seine ursprüngliche Kernkritik weiter ausformulieren:
1. Anschlussfähig waren seine Argumente für die sich entwickelnde Klinische Psychologie und vor allem für die expansiv auftretende Verhaltenstherapie, die sich ein eigenständiges Fachprofil in klarer Absetzung vom »medizinischen Modell« erhoffte (exemplarisch sei das Lehrbuch von Ullman & Krasner, 1969, genannt). Wenn man sich von einer naturgeschichtlich gedachten Biogenese psychischen Leids mit guten Argumenten absetzen kann, haben psycho- und soziogenetische Zugänge eine große Durchsetzungschance.
2. Einem Wissenschaftsverständnis, das auf ontologische Wahrheiten ausgerichtet war – und so wurden auch die Krankheitseinheiten der Psychopathologie verstanden –, wird von Szasz (1960) ein konstruktivistisches Wissenschaftsmodell entgegengesetzt. Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit war vor allem durch die Soziologie (Berger & Luckmann, 1966/1982) und die Philosophie (Searle, 1995/2011) zu einer wichtigen Analyseperspektive geworden, weil sie die Möglichkeit eröffnet hat, starre Welt- und Fachinterpretationen zu dekonstruieren und die Frage zu stellen, welche soziokulturellen Kontextbedingungen die Bedeutungen aufladen, die wir Subjekten und ihrer Welt zuschreiben. Und zugleich enthält diese Perspektive die Möglichkeit, alternative Bedeutungszuschreibungen zu entwickeln und für ihre Geltung zu kämpfen.
3. Die Kritik am medizinischen Modell wurde auch durch Forschungsbefunde aus der transkulturellen Psychiatrie und der Ethnopsychoanalyse gestützt. In der deutschen Debatte war vor allem Erich Wulff (1969) von überragender Bedeutung, der als junger deutscher Psychiater nach Vietnam ging und dort die Erfahrung machte, dass die Kernsymptome etwa der Schizophrenie in Vietnam nicht genauso verstanden und eingeordnet wurden, wie er sie in seiner westdeutschen Sozialisation zu diagnostizieren gelernt hatte. Die europäische Sicht des Individuums, das eine klare und abgegrenzte Ichvorstellung unterstellt, führt dazu, Personen, die diese Vorstellung nicht entwickelt haben, als psychisch krank zu benennen. In Vietnam hingegen werden Menschen, die sich durch ihre Individualitätskonstruktionen aus dem kulturellen Kollektiv herauslösen, nicht als psychisch krank eingeordnet. Wulff (1969) konnte zeigen, wie stark die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen die Vorstellungen von Normalität und Devianz bestimmen.
Einer herrschaftskritischen Sichtweise der Psychiatrie und auch der traditionellen Klinischen Psychologie hat der Text von Szasz (1960) insofern eine wichtige Steilvorlage geliefert, als er ein theoretisches Modell nicht nur als kognitiv-wissenschaftliche Figur kritisierte, sondern auch dessen gesellschaftlich-politischen Konsequenzen thematisierte. So war es möglich, die institutionellen Muster »totaler Institutionen« (Goffman, 1961/1972) und deren Folgen für psychiatrische Patient*innen zu identifizieren, die die klassische Psychopathologie umstandslos als integralen Bestandteil des Krankheitsverlaufes interpretierten. Die empirischen Studien zu den Hospitalisierungsschäden in psychiatrischen Krankenhäusern (vgl. Finzen, 1974) lieferten für diese Dekonstruktion genügend praktische Belege. Sehr prominent wurde in dieser Zeit die »Labeling-Perspektive«. Diese thematisiert und untersucht die jeweils für eine Gesellschaft typischen institutionellen Reaktionsmuster auf abweichendes Verhalten und wie diese den »Karriereverlauf« einer Devianz durch ihren spezifischen Prägestempel erheblich mitbestimmen (Keupp, 1976).