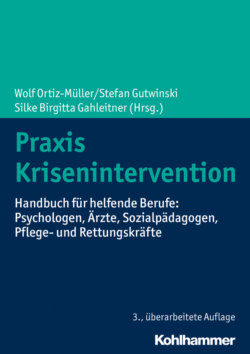Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I Theorie – Krisenintervention verstehen
ОглавлениеIm ersten Teil des Buchs Theorie – Krisenintervention verstehen suchen fünf Beiträge ganz unterschiedliche, gleichwohl aufeinander bezogene Zugänge zur Krise und Krisenintervention. Sie spannen einen Bogen von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen über Krisenmodelle hin zu strukturellen Notwendigkeiten für adäquate Krisenhilfe. Hilfe für Krisenhelfer*innen und die Weiterbildung in der Kernproblematik der Suizidalität runden diese Einführung ab.
Kapitel 1
Angesichts der weltweiten Krisenerscheinungen, die nicht nur wirtschaftliche und politische Umwälzungen nach sich ziehen, sondern auch tief in den sozialen Nahraum hineinwirken, erscheint der Einführungsartikel aktueller denn je. Heiner Keupp erläutert in seinem Beitrag Die Normalität der Krise oder die Krise der Normalität. Krisenpotenziale im globalisierten Netzwerkkapitalismus unter Referenz auf Gegenwartsanalysen der Soziologie die Allgegenwärtigkeit von Krisenerfahrungen. Für das Anliegen dieses Buchs spielen die Konsequenzen für insbesondere sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen innerhalb dieses »spezifisch postmodernen Angstmilieus« eine wichtige Rolle.
Kapitel 2
Krisenintervention - Theorie, Handlungsmodell und praktisches Vorgehen nennt Wolf Ortiz-Müller seinen neu gestalteten und erweiterten Überblicksartikel, der die Entwicklungsgeschichte des Krisenverständnisses und der Krisenintervention nachzeichnet, ohne die die aktuellen Ausdifferenzierungen der Krisenbeschreibungen nicht verständlich wären. Er widmet sich den spannenden Diskussionen, was unter Krisenbewältigung zu verstehen ist und stellt ein Handlungsmodell in sechs Schritten vor, das die Interventionen im praktischen Vorgehen strukturieren kann.
Kapitel 3
Fragen und Themen, die Keupp in seinem sozialpsychologisch-gesellschaftlichen Beitrag aufwirft, finden im Beitrag von Silke Birgitta Gahleitner eine Entsprechung auf der Ebene des Individuums und seiner sozialen Einbindung als weitreichenden Unterstützungsfaktor im tagtäglichen krisenbedrohten Geschehen. Unter dem Titel »Ohne sie wäre ich sicher nicht mehr da«: zur Bedeutung von Bindung, Beziehung und Einbettung bei schweren und wiederholten Krisenerfahrungen führt sie in die Komplexität sozialer Einbettungsprozesse in der Behandlung schwerer und wiederholter Krisen ein. Dabei zeigt sich auch: Ohne ein Wissen um einerseits soziale und gesellschaftliche Prozesse und andererseits klinische Phänomene wie kumulative und komplexe Traumata sind manche Folgeerscheinungen und Bewältigungsstrategien, zu denen insbesondere auch Suizidalität und Selbstverletzung gehören, schwer verständlich und damit auch schwer behandelbar.
Kapitel 4
Der Beitrag von Manuel Rupp Was hilft den Krisenhelfer*innen? –Kurze Praxis der Notfall- und Krisenintervention beschreibt die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Notfall und Krise und stellt die jeweils spezifischen Vorgehensweisen, wenn die Helfenden im ambulanten Setting den Ort der Krise aufsuchen, anschaulich in prägnanten »Checklisten« dar.
Kapitel 5
Wolfram Dorrmanns Beitrag Konzept eines Trainingsseminars für Berater*innen und Psychotherapeut*innen zur Suizidprophylaxe schlägt gleich drei Fliegen mit einer Klappe: Die Leser*innen lernen ein in seiner langjährigen Praxis bewährtes didaktisches Konzept der Weiterbildung zu diesem Thema kennen. Zweitens erhalten sie Anregungen für die Auseinandersetzung mit den eigenen Anteilen im Umgang mit suizidalen Menschen und sie lernen drittens praxisnah, wie auch bei starker Selbstgefährdung noch therapeutisch interveniert werden kann.