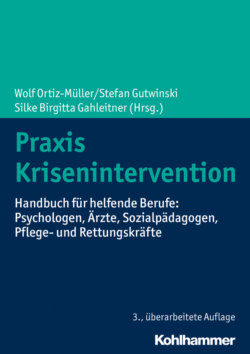Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Notwendigkeit einer Gesellschaftsdiagnostik
ОглавлениеDas renommierte naturwissenschaftliche Journal »Nature« ruft im ersten Januarheft 2010 eine »Dekade für psychiatrische Störungen« (Campbell, 2010) aus. Begründet wird diese Priorität damit, dass psychische Störungen wie Schizophrenie und Depressionen die vorherrschenden Störungen der Altersgruppe von 15 – 44 Jahre ausmachten. Hinzu kommt die wachsende Anzahl von ADHS-Diagnosen bei Kindern. Die Behandlung dieser Störungen machen etwa 40 % der medizinischen Kosten in den USA und Kanada aus. Die biologische Psychiatrie reklamiert für sich die zeitgemäßen Erklärungen und Therapien!
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) bezieht sich ausdrücklich auf diese Position von »Nature« (Campbell, 2010) und fordert 2010 ein »Deutsches Zentrum für Psychische Störungen«. Begründet wird diese Forderung damit, dass die psychischen Störungen eine Volkskrankheit seien, die sich in den modernen Gesellschaften sukzessiv ausweiteten. Die Zeit sei reif für eine wissenschaftliche Revolution! Was darunter genau zu verstehen ist, wird von wichtigen Vertretern der DGPPN so ausgeführt:
»Die rasche Entwicklung von Forschungsmethoden in der Genomik (parallele Erfassung einer Vielzahl von genetischen und funktionellen Varianten) und Bildgebung haben unser Wissen über psychische Krankheiten in relativ kurzer Zeit enorm bereichert. So wurden auch neue Methoden in die Psychiatrie übernommen, so z. B. die genetische Epidemiologie, die systemischen Neurowissenschaften, funktionelles Neuroimaging, Genomic Imaging oder Proteomik. Ein erheblicher Erkenntniszuwachs resultiert auch aus der Entwicklung von innovativen Tiermodellen. Ein weiterer zukünftiger Entwicklungsschritt ist von der Stammzelltechnologie zu erwarten, mit welcher zellbiologische Modelle für psychische Erkrankungen entwickelt werden könnten.« (Schneider, Falkai & Maier, 2012, S. 14)
Hat diese Programmatik noch etwas gemeinsam mit dem biopsychosozialen Modell von Engel? Wo ist der Bezug auf die psychische Situation, die sozialen Lebensbedingungen und auf ökologische Systemfaktoren? Bei aller Begeisterung für die Biosphäre der menschlichen Existenz, die durch die Neurowissenschaften und die Genforschung ausgelöst wurde, fragt man sich, ob denn auf dieser Grundlage etwa die Zunahme von Burn-out und Depressionen oder Zuwachsraten bei den ADHS-Diagnosen erklärt werden können. Und es stellt sich die Frage, ob angesichts eines offensiven Rebiologisierungsprozesses in der Psychiatrie und zunehmend auch in der Psychologie die von Engel (1977/1979) vorgeschlagene Balance zuungunsten der Sozialwissenschaften verloren geht und deshalb jetzt eine selbstbewusste sozialwissenschaftliche Initiative im Sinne einer expliziten »Gesellschaftsdiagnostik« (Keupp, 2013) und eine »Re-Sozialisierung« von Normalität und Abweichung notwendig sind.
Ein neuer Höhepunkt im revitalisierten Medikalisierungstrend ist mit dem DSM-5 erreicht, bei dem immer weiter in den Alltag eingreifenden Pathologisierungshaltung auch in der psychiatrischen Fachszene heftige Kritik ausgelöst hat. Exemplarisch dafür steht die Streitschrift von Allen Frances (2013), die unter dem Titel »Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnose« in deutscher Sprache erschien. Frances ist kein psychiatriekritischer Geist, sondern gehört zum fachlichen Establishment und war verantwortlicher Vorsitzender der Kommission, die das DSM-5 erarbeitet hatte. Der Autor reflektiert seine eigene frühere Rolle und zeigt auf, wie problematisch es ist, wenn neue Krankheitsbilder konstruiert werden, die vor allem der Pharmaindustrie neue Profitmöglichkeiten eröffnet. Beim DSM-5 sieht er vor allem die Gefahr, dass zum Alltag und zum menschlichen Leben gehörende Sorgen und Gefühlslagen zu psychischen Krankheiten umgedeutet werden (vgl. die kritischen Analysen von Greenberg, 2013; Burstow, 2015).
Der unverzichtbare Beitrag der Sozialwissenschaften lässt sich exemplarisch an der Auseinandersetzung aufzeigen, warum die Depression – bis hin zur Weltgesundheitsorganisation –als »Volkskrankheit Nr. 1« bezeichnet wird. Der Buchtitel von Alain Ehrenberg (1998/2004) »Das erschöpfte Selbst« ist zum nichtfachlichen Synonym für den Zustand der Depression geworden, aber nicht im Sinne einer vermeintlich kontextfreien psychopathologischen Diagnostik, sondern als Teil einer Gesellschaftsdiagnostik, die einen Zusammenhang zwischen subjektiven Erfahrungen und gesellschaftlichen Entwicklungen herstellt.
In der Geschichte der Diskurse über Normalität und Abweichung haben sich charakteristische Verschiebungen der Deutungsmächte vollzogen. Solange Abweichung von der Norm als Verletzung einer Ordnung angesehen wurde, die einem göttlichen Schöpfungsplan folgt, gab es eine religiöse Deutungsdominanz. Mit der Verwissenschaftlichung des Devianzfeldes wurden höchst unterschiedliche Erklärungsmodelle für Abweichungen von der Norm formuliert. Das »Pathologiemodell« unterstellte spezifische Krankheitsursachen und -einheiten und suchte seine Gewissheiten über naturwissenschaftliche Erklärungen zu gewinnen. Die psychogenetischen Modelle haben unterschiedliche biografische Entwicklungsverläufe oder Lerngeschichten entwickelt, um Normalitätsverfehlungen erklären zu können. Erweitert werden diese noch durch soziogenetische Konzepte, die Devianzentstehung aus den sozialen Lebensbedingungen heraus plausibel machen. Diese Modelle haben sich mit ihren jeweiligen Alleinvertretungsansprüchen heftig bekämpft. Inzwischen hat sich auf breiter Grundlage eine konstruktivistische Perspektive durchgesetzt, die allen Wahrheitsansprüchen den Boden entzieht und Devianzkategorien den Status pragmatisch sinnvoller Konstrukte zuordnet, die wiederum den zuständigen Professionen Kommunikations- und Handlungssicherheit geben sollen. Von Bedeutung ist nicht mehr die »Wahrheit« von Normalität und Abweichung, sondern das Interventionspotenzial: Welche therapeutischen, beraterischen oder korrektiven Maßnahmen können oder sollen eingeleitet werden, um den Störungswert eines Verhaltens oder Erlebens so zu verändern, dass sie den normativen Erwartungen innerhalb einer jeweiligen Kultur besser entsprechen?
Gibt es aber in pluralen Gesellschaften überhaupt noch einheitliche Normalitätsstandards, oder besagt nicht die Feststellung, dass wir uns in einer postmodernen Gesellschaft befinden, dass »anything goes«? Innerhalb einzelner Lebenswelten und Milieus gibt es meist sehr klare Vorstellungen für das, was als Normalität und Abweichung angesehen wird, und hier entsteht auch der Ausgrenzungsdruck auf Menschen, die den Erwartungen nicht entsprechen, oder der Leidensdruck bei Personen, die den Erwartungen nicht entsprechen können, obwohl sie genau dies wollen.
Wenn Normalität und Abweichung als soziale Konstruktionen rekonstruiert werden können, ist es auch möglich, sie zu »dekonstruieren«. Dekonstruktion kann als »konstruktive Zerstörung und Demystifikation« angesehen werden. In aller Regel sind diese dekonstruktiven Prozesse eingebunden in soziale Bewegungen, die die soziale Wahrnehmung und die gesellschaftliche Stellung spezifischer Gruppen verändern wollen (von der Frauen-, der Schwulen- und Lesbenbewegung bis zur Behindertenbewegung). Wenn sie erfolgreich sind wie im Falle der Schwulenbewegung, gelingt es, eine sexuelle Orientierung, die über Jahrzehnte als pathologische Abweichung galt, in das Diskursfeld der Normalität zu verschieben.
Es gibt gute Gründe, sich von der Polarität von Normalität und Abweichung zu verabschieden und mehr danach zu fragen, welche Ressourcen Menschen in spezifischen Lebenssituationen brauchen, um zu einer souveränen Lebensführung zu gelangen.