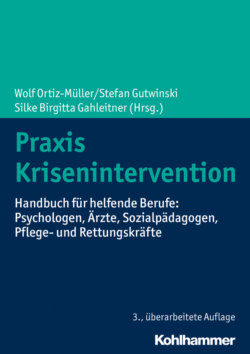Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.7 Die gesellschaftliche Auflösung stabiler Koordinaten
ОглавлениеAn den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit seine Freude, der ja alles im Fließen sah. Heute wird uns eine »fluide Gesellschaft« oder die »liquid modernity« (Bauman, 2000) zur Kenntnis gebracht, in der alles Statische und Stabile zu verabschieden ist. In der Überschreitung bislang eingehaltener Grenzziehungen von Normalbiografien, Normalitäten und alltäglichen Selbstverständlichkeiten entstehen neue Arrangements und neue Kombinations- und Fusionsmöglichkeiten, die nicht mehr dem klassischen Muster sozialen Wandelns folgen. Nachdem Veränderungen zu einer großen Krise führen, können mit deren Bewältigung auch wieder neue stabile und berechenbare Geschäfts- und Lebensgrundlagen entstehen. Normalität wird sich wohl kaum mehr als ein relativ überdauernder stabiler Erwartungshorizont konstituieren. Vielleicht ist es eher die Gewissheit des »unheilbar« offenen Horizontes und der – je nach subjektiver Konstellation – gelassenen Sicherheit, in diesem widersprüchlich-offenen Prozess mit einer eigenen Identitätspositionierung zurechtzukommen ( Abb. 1.1).
Wenn wir uns der Frage zuwenden, welche gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen die gesellschaftlichen Lebensformen der Menschen heute prägen, knüpft dies an den Gedanken des »Disembedding« (Giddens, 1990/1995) oder der Enttraditionalisierung an. Dieser Prozess lässt sich als tief greifende Individualisierung einerseits und als explosive Pluralisierung andererseits beschreiben. In dem Maße, wie sich Menschen herauslösen aus vorgegebenen Schnittmustern der Lebensgestaltung und zunehmend ein Stück eigenes Leben gestalten können, aber auch müssen, wächst die Zahl möglicher Lebensformen und damit möglicher Vorstellungen von Normalität und Identität. Peter Berger (1992/1994, S. 83) spricht von einem »explosiven Pluralismus«, ja von einem »Quantensprung«. Seine Konsequenzen benennt er so:
»Die Moderne bedeutet für das Leben des Menschen einen riesigen Schritt weg vom Schicksal hin zur freien Entscheidung. […] Aufs Ganze gesehen gilt […], daß das Individuum unter den Bedingungen des modernen Pluralismus nicht nur auswählen kann, sondern daß es auswählen muß. Da es immer weniger Selbstverständlichkeiten gibt, kann der Einzelne nicht mehr auf fest etablierte Verhaltens- und Denkmuster zurückgreifen, sondern muß sich nolens volens für die eine und damit gegen die andere Möglichkeit entscheiden. […] Sein Leben wird ebenso zu einem Projekt – genauer, zu einer Serie von Projekten – wie seine Weltanschauung und seine Identität.« (Berger, 1992/1994, S. 95; Hervorh. i. Orig.)
Als ein weiteres Merkmal der »fluiden Gesellschaft« (Bauman, 2000) wird die zunehmende Mobilität benannt, die sich u. a. in einem häufigeren Orts- und Wohnungswechsel ausdrückt. Die Bereitschaft zu diesen lokalen Veränderungen folgt vor allem aus der Logik der Arbeitsmärkte, die ein flexibles Reagieren auf veränderte Marktbedingungen erfordert und die immer weniger beständige Betriebszugehörigkeiten sichert. Der »flexible Mensch« (wie ihn Sennett 1998 beschrieben hat) – so
Abb. 1.1: Reflexive Modernisierung: fluide Gesellschaft, eigene Darstellung nach Barz, Kampik, Singer und Teuber (2001)
jedenfalls die überall verkündete Botschaft – muss sich von der Idee der lebenslangen Loyalität gegenüber einer Firma lösen, er muss sich in seinem Arbeitsmarktverhalten an die ökonomisch gegebenen Netzwerkstrukturen anpassen.
Individualisierung, Pluralisierung, Flexibilität und Mobilität gehören also immer mehr zu den Normalerfahrungen in unserer Gesellschaft. Sie beschreiben strukturelle gesellschaftliche Dynamiken, die die Lebensformen von Menschen heute prägen. Anthony Giddens (1999/2001), einer der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnostiker, hat aufgezeigt, dass ein so abstrakter Begriff wie Globalisierung dann anschaulich wird, wenn er auf seinen subjektiv erfahrenen Kern verdichtet wird:
»Die wichtigste der gegenwärtigen globalen Veränderungen betrifft unser Privatleben – Sexualität, Beziehungen, Ehe und Familie. Unsere Einstellungen zu uns selbst und zu der Art und Weise, wie wir Bindungen und Beziehungen mit anderen gestalten, unterliegen überall auf der Welt einer revolutionären Umwälzung. […] In mancher Hinsicht sind die Veränderungen in diesem Bereich komplizierter und beunruhigender als auf allen anderen Gebieten. […] Doch dem Strudel der Veränderungen, die unser innerstes Gefühlsleben betreffen, können wir uns nicht entziehen.« (Giddens, 1999/2001, S. 69)
Globalisierung verändert also den Alltag der Menschen in nachhaltiger Form und damit auch ihre psychischen Befindlichkeiten. Und dieser Alltag verändert sich so, dass es keinen Rückweg zu einer einfachen und überschaubaren Erfahrungswelt mehr gibt. Bezogen auf die Pluralisierung von Lebenswelten hat dies Isolde Charim (2018) eindrucksvoll aufgezeigt. Aber viele Menschen erleben gerade einen Veränderungsdruck, der ihnen Angst macht. Wird diese Angst zu stark und finden die Menschen keine produktiven Lösungen, entsteht leicht Gewalt, aber auch Apathie und Demoralisierung. Es können aber auch Ersatzlösungen Konjunktur bekommen: Ressentiments gegen alles Fremde und Neue, eine rückwärtsgewandte Verklärung der Vergangenheit. Sekten und politische Rattenfänger bieten »Lösungen«, die die Möglichkeit von Ordnung, Sicherheit und Klarheit suggerieren.