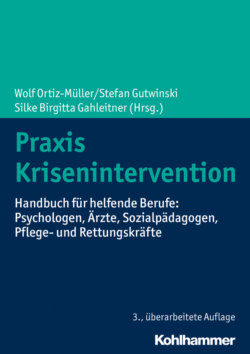Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.8 Wie produktive Angstbewältigung aussehen könnte
ОглавлениеWenn die kulturell eingeregelten Muster für die Auseinandersetzung und Bewältigung mit und von Krisen nicht mehr ausreichen, entstehen Ängste. Ja, Angst tritt auf, wenn im Alltag die Vertrauensgrundlage für unser Handeln infrage gestellt ist. In ihrer subjektiven Befindlichkeit sind Menschen von ihren Lebensbedingungen in hohem Maße abhängig. Sie benötigen gesicherte Alltagsfundamente. Ich muss mich beim Aufstehen darauf verlassen können, dass die meisten unserer normalerweise eingespielten Handlungsroutinen auch noch gültig sind und tragen. Aber das ist in einer Zeit hoher Wandlungsdynamik nicht immer der Fall. Es lässt sich ein weites Panorama von sozialen Krisen und Belastungen aufzeigen, die die Lebensführung, das konkrete Erleben und Handeln von Subjekten betreffen, also auch systematische Quellen für Ängste bilden können.
Entscheidend ist die Klärung der Ursachen der Ängste. Für alle Ängste, die nicht nur einen ganz privaten Hintergrund haben, sind kollektive Klärungen notwendig und darauf aufbauend konstruktiv-produktive Formen der Bewältigung, die nicht das einzelne Subjekt individualistisch zu suchen hat, sondern es bedarf gesellschaftlicher Lösungen.
Wie könnte gesellschaftliche Angstverarbeitung aussehen? Ich möchte den Blick auf drei Formen richten:
(1) Gesicherte Normalitätsschablonen: Naturkatastrophen, auch Kriege führen zu Angst, Krisen, Not und Leid in oft dramatischem Ausmaße. Aber sie verändern nicht unbedingt die bestehenden »Normalformtypisierungen«,2 die Konzepte von Normalität. Sie stellen nicht nur für die positive Gestaltung von Biografien, Identitäten oder Berufskarrieren »einbettende Kulturen« dar, sondern auch für Krisen und Ängste. Christian von Ferber (1995) hat dies eindrucksvoll an der Verarbeitung der deutschen Katastrophen in diesem Jahrhundert aufgezeigt. Er geht von der These aus, dass
»gesellschaftliche Umbrüche zu individuellen Krisen (werden), wenn sie eine als selbstverständlich geltende Normalität bedrohen, gefährden oder aufheben. Gesellschaftliche Umbrüche sind mit individuellen Krisen durch Interpretationen von Situationen, durch Deutungen also verbunden. Für die politischen und für einige wirtschaftliche Veränderungen liegen aus den Erfahrungen in diesem Jahrhundert gesellschaftliche Deutungsmuster bereit, die diese Verknüpfungen herstellen und sie sinnhaft strukturieren. […] Für die Folgen von Kriegen, politischen Systemwechseln, für wirtschaftliche Massenarbeitslosigkeit ist ein Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Umbrüchen und individuellen Krisen hergestellt und in kollektiven Deutungsmustern aufgearbeitet.« (Christian von Ferber, 1995, S. 18 f.)
Allerdings ist genau dieses Bewältigungsmuster heute brüchig geworden, wie Ferber ausführt:
»Für die westlichen Industrieländer […] stellt sich gegenwärtig die Frage, ob die überkommenen Deutungsmuster ausreichen, ob die quantitativen Veränderungen im Wirtschaftswachstum und im Massenwohlstand nicht auch zu einem qualitativen Wandel, zu Einbrüchen oder Zäsuren in der als selbstverständlich geltenden Normalität geführt haben.« (Christian von Ferber, 1995, S. 18 f.)
Die Rückkehr zu einem solchen unverrückbaren Konzept von Normalität, an dem man den eigenen Lebensentwurf immer wieder ausrichten könnte, wird es nicht mehr geben. Es kommt vielmehr darauf an, in diesen Normalitätsveränderungen und -pluralisierungen eine Chance und eine Notwendigkeit zu sehen. Viele trauern Lebensmodellen hinterher, die zwar ein Gerüst für die individuellen Identitäten boten, aber zugleich den Charakter eines Korsetts oder einer Prothese hatten. Selbstgestaltung, die Möglichkeit zu einem eigenen Lebensentwurf – das sind neue Potenziale, die sichtbar gemacht werden müssen. Hier muss über die erforderlichen Ressourcen und Möglichkeiten gesprochen werden, materielle, soziale und psychische, die in unserer Gesellschaft immer ungleicher verteilt sind, und damit auch über die Lebenschancen.
(2) Soziale Bewegungen können individualisierte Ängste als kollektive Bedrohungen definieren und politische Veränderungsinitiativen aufbauen. So können Ängste als motivationale Basis für gesellschaftliches Umdenken produktiv werden. Die Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl mag hier als Beispiel dienen. Dieser menschheitsbedrohende Unfall hat nicht nur die Risiken der Kernkraft deutlich gemacht, er hat vor allem eine emotionale Tiefenwirkung erlangt, die sich in eindrucksvolle Widerstandspotenziale transformiert hat. Manuel Castells (1997/2002) fragt im zweiten Band seiner Trilogie (deutscher Titel: »Die Macht der Identität«) nach den Konsequenzen der globalisierten »Netzwerkgesellschaft« (Castells, 1997/2002, S. 60) für die Herausbildung kollektiver Identitäten. Er sieht zunächst den zunehmenden Funktionsverlust aller Formen von »legitimierender Identität« (Castells, 1997/2002, S. 8). Das sind jene Muster, die sich an den klassischen Spielregeln nationalstaatlicher Gesellschaften ausgerichtet haben. Als eine spezifische identitätspolitische Reaktanzbildung auf die »Netzwerkgesellschaft« (Castells, 1997/2002, S. 60), in der sich lokale und Verbindlichkeit vermittelnde soziale Beziehungen verflüchtigen, sieht er weltweit das Entstehen von fundamentalismusträchtigen Formen einer »Widerstandsidentität« (S. 10): Sie entstehen aus einer defensiven Identitätspolitik von Gruppen, sozialen Bewegungen oder auch einzelnen Personen, die sich gegen die vorherrschende Dominanzkultur der »realen Virualität« (S. 72) in der Gestalt von konstruierten kollektiven Wir-Figurationen wehren, die auf lokale, kulturelle oder religiöse Eindeutigkeiten und Grenzziehungen bestehen. Ihr Grundprinzip formuliert Castells (1997/2002) als »den Ausschluss der Ausschließenden durch die Ausgeschlossenen« (S. 11). Von diesen Reaktanzformen kollektiver Identität unterscheidet Castells das Muster der »Projektidentität« (S. 10). Ihr Entstehungsprozess läuft in aller Regel über irgendeine Form von widerständiger Identität, aber sie bleibt nicht in der Verteidigung partikularistischer eingespielter Lebensformen stehen, sondern entwirft Vorstellungen neuer selbstbestimmter Identitätsfigurationen in einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, die in ihrem Anspruch universalistisch ausgerichtet ist. Projektidentitäten bilden sich in sozialen Bewegungen (z. B. in der Frauen- oder in ökologischen Bewegung) heraus.
(3) Auch wenn in einer individualisierten Gesellschaft die Basis für gesellschaftsweite Bewegungen schwieriger geworden ist, bleiben Chancen für die Vergesellschaftung der Angstsignale und Krisenerfahrungen in Gestalt von Selbsthilfegruppen und Projekten bürgerschaftlichen Engagements.