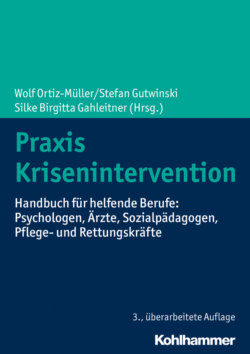Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.9 Schlussgedanke
ОглавлениеDie psychosoziale Arbeit könnte für das Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen krisenhaften gesellschaftlichen Lebensbedingungen und psychischen Problemen eine wichtige seismografische Funktion haben. Sie arbeitet an den Krisen der Subjekte und ist damit konfrontiert, dass ihnen die Ressourcen fehlen, die sie zu ihrer Bewältigung bräuchten. Die Häufung spezifischer Krisen und Störungsbilder verweist aber über das einzelne Subjekt hinaus und macht es erforderlich, den kulturell-gesellschaftlichen Hintergrund, der diese Krisen fördert, zu beleuchten und zu benennen. Sind die psychosozialen Professionen auf eine solche Aufgabe vorbereitet? Ist es noch ein Thema in psychotherapeutischen Kontexten, sich zu vergewissern, in welcher Gesellschaft wir uns eigentlich befinden und was es bedeutet, in einem solchen Rahmen psychotherapeutisch zu arbeiten?
Der Psychoanalytiker Cyrus Khamneifar (2008) stellt fest, »dass die kultur- und gesellschaftskritische Seite der Psychotherapie im ›offiziellen‹ klinischen Alltag unterrepräsentiert zu sein« (S. 4) scheint. Aber er wollte es genauer wissen und sich nicht nur auf unsystematische Impressionen verlassen. Vor allem ist ihm aufgefallen, dass in den eher informellen Gesprächen durchaus über gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf das eigene Leben und das der Klient*innen gesprochen wurde. Aber die Frage blieb, wie sich solche Diskurse auf die fachlich-psychotherapeutische Arbeit auswirken. Er hat Psychotherapeut*innen folgende Frage gestellt, auf die noch weitere differenzierende Fragen folgten: »Erleben Sie den gesellschaftlichen Wandel oder anhaltende gesellschaftliche Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, und wenn ja, wie?« (Khamneifar, 2008, S. 8).
Thematisiert wurde der Weg zu postmodernen Familienverhältnissen, in denen sich auch das Geschlechterverhältnis aus traditionellen Genderkonstruktionen herauslöst. Es wird deutlich, dass sich die Sozialisationsbedingungen für Heranwachsende strukturell verändern. Der Strukturwandel der Arbeitswelt führt zu weniger stabilen Karrieren und Sicherheiten. Der von der Wertewandelforschung untersuchte säkulare Wertewandel wird von den Psychotherapeut*innen klar benannt und vor allem der immer höhere Stellenwert des Anspruchs auf Selbstverwirklichung in seiner durchaus ambivalenten Form thematisiert. Als komplementär-widersprüchliches Muster wird die Sehnsucht nach Heimat und sozialer Verortung herausgestellt. Die immer stärker erlebte Unsicherheit und Ungewissheit befördern die Suche nach Wissen, aber auch nach Strategien mit Erfahrungen des Nichtwissens oder der »Unlesbarkeit« der Welt, wie es Richard Sennett (1998) formuliert.
Im nächsten Schritt fasst Khamneifar (2008) die spätmodernen Anpassungsversuche der Subjekte an ihre strukturell veränderte Alltagswelt zusammen, und auch hier erweisen sich die Befragten als sensible Beobachter*innen. Sie sprechen Phänomene an wie die Fitnessideologie, Anspruch auf Selbstmanagement, Konsumismus, wachsenden Leistungsdruck, unaufhaltsame Beschleunigung, zunehmenden Jugendlichkeitskult und Abhängigkeit von neuen Technologien. Auch bei der Frage, welche Folgen der gesellschaftliche Wandel für die Psychotherapie hat, zeigen sich die Gesprächspartner*innen von Khamneifar (2008) als durchaus problembewusst. Sie thematisieren bei den Rahmenbedingungen psychotherapeutischen Handelns eine problematische Ökonomisierung, Modularisierung und Medikalisierung. Ebenso werden die im gesamten Sozial- und Gesundheitssektor einsetzende sogenannte »Qualitätssicherung« und die damit verbundenen »staatlichen und quasi-staatlichen (Selbst-)Verwaltungsreglementierungen« (Khamneifar, 2008, S. 182) angesprochen. Mich hat die gesellschaftliche Problemsensibilität der befragten Psychotherapeut*innen beeindruckt. Sie unterscheidet sich deutlich von der Fachliteratur, den Lehrbüchern (Ausnahme: Auckenthaler, 2012) und den Ausbildungscurricula. Hier ist es auf jeden Fall legitim, von Gesellschaftsvergessenheit zu sprechen.