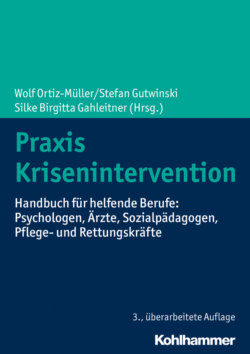Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Die Krisenkonzepte der 1940er–1970er Jahre: Traumatische Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise
ОглавлениеUnser heutiges Verständnis von Krise hat mehrere historische Wurzeln. Als Ausgangspunkt der Konzeptualisierung der »traumatischen Krise« gilt der Cocoanut-Grove-Brand von 1942, als in einem Tanzlokal in Boston 492 Menschen ums Leben kamen. Der Psychiater Erik Lindemann begleitete die Überlebenden und untersuchte die Trauerreaktionen der Hinterbliebenen. Seine Veröffentlichung zur Symptomatik und Behandlung akuter Trauer (1944) legte die Grundlagen für das Verständnis traumatischer Verlusterfahrung und dysfunktionaler Bewältigung.
In seiner Nachfolge entwickelte der schwedische Psychiater Johan Cullberg (1978) ein Phasenmodell der traumatischen Krise.
Definition: »Die traumatische Krise ist eine durch einen Krisenanlass mit subjektiver Wertigkeit plötzlich aufkommende Situation von allgemeinschmerzlicher Natur, die auf einmal die psychische Existenz, die soziale Identität und Sicherheit und die fundamentalen Befriedigungsmöglichkeiten bedroht.«
Abb. 2.1: Phasen der traumatischen Krise (nach Cullberg, 1978)
Maßgeblichen Einfluss auf die Krisentheorie nahm in den 1960er Jahren Gerald Caplan (1964), der den Begriff der Veränderungskrise prägte. Gemeinsam mit Lindemann gründete er das erste Community Crisis Center, das von der sozialpsychiatrischen Idee geleitet war, psychiatrische Klinikaufenthalte vermeiden zu können, wenn gemeindenahe Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Sein Phasenmodell wird in Abb. 2.2 dem von Cullberg gegenübergestellt.
Von Caplan stammt auch die Krisendefinition, die die weiteste Verbreitung gefunden hat.
Definition: Eine Krise ist durch den Verlust des seelischen Gleichgewichts gekennzeichnet, wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie seine bisherigen Problemlösefähigkeiten übersteigen.
Er bezieht also bei der Betrachtung von Krisen die von ihnen in der Vergangenheit erworbenen Bewältigungsmuster in die aktuelle Herausforderung der Menschen mit ein. Zu einer Krise kommt es erst, wenn hier ein Ungleichgewicht entsteht, das zu einem anderen Zeitpunkt – früher oder später – nicht bestanden hat oder nicht weiterbestehen muss. Als Anlässe werden sowohl äußere Ereignisse begriffen, als auch – weitgefasster – Lebensumstände, die sich nicht notwendigerweise als dramatisch darstellen müssen.
Abb. 2.2: Phasen der Veränderungskrise (nach Caplan, 1964)
Eine einflussreiche Erweiterung erfährt der Krisenbegriff durch Erikson (1966), indem er eine Einteilung des Lebens in Stadien von Kindheit und Jugend bis ins hohe Alter trifft, in denen jeweils eine bestimmte Entwicklungsaufgabe zu lösen sei. Nach dieser Auffassung erscheint jeder Entwicklungsschritt als potenzielle Krise, insofern ein Gelingen oder aber ein Scheitern möglich ist ( Tab. 2.1).
Tab. 2.1: Eriksons Lebensphasen/Aufgaben-Modell (nach Erikson, 1966)
Mehr noch als bei den anderen Autoren wird deutlich, dass Krisen zum Leben dazugehören und Entwicklung mit dem Bestehen von Herausforderungen verknüpft sind, an denen man jedoch auch scheitern kann.
Während bei Lindemann, Caplan, Cullberg und Erikson der jeweilige Fokus auf dem Krisenverlauf lag, entstanden in anderen Feldern der Psychologie neue Erkenntnisse, die die Weiterentwicklung der Krisenintervention beeinflussten. Die wesentlichen Impulse seien hier skizziert: