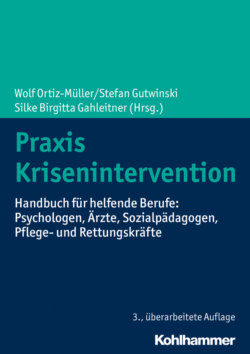Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.4 Kritische Lebensereignisse und Krisenauslöser
ОглавлениеDie Rolle sogenannter »Kritischer Lebensereignisse« als Krisenauslöser wird seit jeher diskutiert. Sigrun-Heide Filipp und Peter Aymanns (2018) haben mehr als 1 000 Publikationen ausgewertet, um übergreifende Zusammenhänge aufzuspüren, in denen Ereignisse und besondere Umstände regelhaft eine Krise auslösen können. Sie sichten sämtliche in der Literatur diskutierten Kategorien, die als Auslöser beschrieben wurden und ordnen diese systematisch ein.
Unter »stress of life« sind banal anmutende Alltagswidrigkeiten wie beispielsweise ein morgendliches Überkochen der Milch, ein Reißen des Schnürsenkels oder die unfreundliche Begrüßung auf der Arbeit zu verstehen. Ereignisse, die sich zu Überforderungsgefühlen summieren können. Hingegen gelten als »non-normativ« sowohl Naturkatastrophen als auch »man-made«-Erschütterungen, die kollektiv (wie der 9/11 – Terrorangriff auf die TwinTowers in New York) als auch individuell (wie ein unerwarteter Tod eines Kinds oder ein Raubüberfall) belastend wirken. Als geradezu erdbebenähnliche Ereignisse, »seismic events« gelten solche, die das eigene Modell der Welt als einem sicheren, im Wesentlichen kontrollierbaren Platz in Frage stellen. Etwa wenn Gewalt von einer nahestehenden Person ausgeübt wird. Jedoch auch »non-events«, der Nichteintritt positiver Ereignisse wie ein Ausbleiben einer lebenspartnerschaftlichen Bindung oder ein unerfüllter Kinderwunsch können Krisen auslösen. Universell gültige Merkmale der Krisenauslösung sind jedoch nicht beschreibbar, gleichwohl steigt die Wahrscheinlichkeit, in eine Krise zu geraten, mit der individuellen Außergewöhnlichkeit für die betroffenen Menschen.
Als eine naheliegende Möglichkeit die Krisenvielfalt zu ordnen, erscheint die Beschreibung der unterschiedlichen Krisenauslöser, woraus man auf ein weiteres Vorgehen bei der Intervention schließt. Dross (2001) wie auch Stein (2019) unterscheiden dabei zwei Arten von Krisenanlässen:
• Bedrohung oder Überforderung liegt vor bzw. wird antizipiert: beruflicher oder familiärer Stress, eine drohende Trennung vom Partner, die Gefährdung des Arbeitsplatzes, Entscheidungsdruck bei Lebensveränderungen usw.
Als gemeinsames Merkmal erscheint die Reversibilität aufgrund der Zeitdimension: Das »krisenhafte Ereignis« ist noch nicht eingetreten, der Arbeitsplatz ist noch nicht verloren, der Partner ist noch nicht weg. Somit scheint eine Einflussnahme noch möglich, was nur »droht«, kann noch abgewendet werden. Tritt das Ereignis dennoch ein, z. B. die Trennung des Partners, wird daraus oftmals ein irreversibler Verlust. Wie sehr sich damit die Qualität der Krise für die Betroffenen ändert, ist einzelfallabhängig.
• Verlust oder erlittene Schädigung (mit irreversiblem Ergebnis) einer nahestehenden Person, zum Opfer eines Unfalls oder einer Gewalttat werden, schwer verletzt oder erkrankt sein, in einer Prüfung versagen usw.
Auch diese Zuordnung weist für eine Orientierung in der Praxis ihre Tücken auf: Unter dem Auslösemerkmal »Verlust« versammeln sich dann doch sehr unterschiedliche Krisenarten: In der Praxis benötigen traumatische Krisen infolge eine Gewalttat ganz andere Vorgehensweisen als durch Prüfungsversagen ausgelöste Krisen, die zwar bis hin zur Suizidalität subjektiv enorm belastend sein können, dabei aber kaum an die ICD- oder DSM-Kriterien für eine akute Belastungsreaktion bzw. PTBS heranreichen ( Kap. 15 Purtscher-Penz & Penz).
Die konkreten Auslöser einer Krise differieren in der Praxis so stark, dass sie oft unterschiedlichen Krisentypen gleichermaßen zuzuordnen wären: Nimmt man den oft beschriebenen Krisenanlass »Verlust durch Tod eines nahen Menschen«, so ist ersichtlich, dass je nach Begleitumständen ganz unterschiedliche Krisenarten daraus erwachsen können.
Abb. 2.5: Krisenanlass und -verlauf
Sterben die eigenen Eltern zu einem Zeitpunkt, wo die Kinder bereits erwachsen sind, wird es häufig ohne Krisenerleben verarbeitet werden können oder als Reifungskrise verstanden werden. Geschieht der Tod der Eltern jedoch unerwartet, »vor der Zeit« oder haben die Eltern z. B. aufgrund einer nicht-erfolgten Ablösung eine überwertige Bedeutung für das Kind, kann ihr Tod sowohl Züge einer traumatischen Krise, als auch einer Veränderungskrise annehmen. Der Tod eines Kindes kann je nach Begleitumständen (plötzlich oder doch vorhersehbar) und Ressourcen sehr unterschiedlich wirken, oft sogar so, dass Vater und Mutter nicht dasselbe Krisenerleben und eine ähnliche Verarbeitung miteinander teilen können.