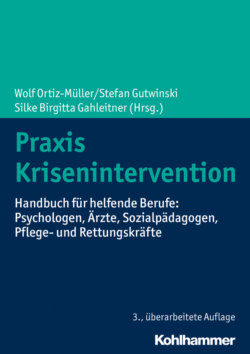Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Krisentheorien
ОглавлениеIn den siebzehn Jahren nach der ersten Auflage 2004 sind weitere wichtige Beiträge erschienen, die uns helfen, das psychosoziale Krisengeschehen besser einzuordnen, jedoch ohne dass die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten Krisentheorien in übergreifende Neukonzeptionen einmünden. Es lassen sich aber sowohl fundierte Überblicksarbeiten zur Bedeutung kritischer Lebensereignisse (Filipp & Aymans 2009) als auch differenzierende Werke zur Methodik und den Anwendungsmöglichkeiten von Krisenintervention (Stein, 2020) finden. Je nach Standpunkt und Arbeitsfeld der Autor*innen werden die tradierten Konzepte mal wohlwollender, mal kritischer gewürdigt. Um der entstandenen Vielfalt in der Krisenintervention gerecht zu werden, wird häufig ein ähnlicher Ansatz wie in diesem Band gewählt, nämlich die Auffächerung der Darstellung nach den mannigfachen Praxisfeldern (Riecher-Rössler, Berger, Yilmaz & Stieglitz 2004).
Aus benachbarten sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Feldern sind neue Ansätze in die Krisenarbeit integriert worden wie umgekehrt das Verständnis der Krisenintervention Einzug in manche Bereiche gehalten hat, z. B. der klinischen Sozialarbeit (Ortiz-Müller, 2008). In einer Gegenwart, in der gesellschaftliche Veränderungsprozesse rasant verlaufen und Sozialsysteme erodieren, während die Zwei-Klassen- Gesundheitsversorgung fortgeschrieben wird, erleben scheinbar »alte« Ansätze wie die der Sozialen Diagnose von Alice Salomon eine Wiederentdeckung (Salomon, 1926; Gahleitner, Pauls & Glemser, 2018). Ein psychosozialer, biografiesensibler Blick sollte danach in der Lage sein, beide Dimensionen des (Er-)Lebens, das Innerpsychische in seiner Wechselwirkung mit dem sozialen Kontext, miteinander zu verknüpfen.
Keupps Beschäftigung mit den Chancen und Risiken der Netzwerkgesellschaft ( Kap. 1 Keupp, sowie Keupp 2003) oder Lenz’ Beiträge zur Bedeutung sozialer Netzwerke als Ressource in einer Gesellschaft, die von Fragmentierungsprozessen und raschem Wertewandel bzw. -verfall geprägt ist (Lenz, 2007; vgl. auch Nestmann, 2010), nehmen eine verstärkt sozialwissenschaftliche Perspektive ein und verdeutlichen die immanenten Schranken eines ausschließlich individualpsychologischen Verständnisses. Jedoch auch frühere Arbeiten aus dem sozialwissenschaftlichen Spektrum weisen bereits auf die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Bewältigung postmoderner Lebensverhältnisse hin (Nestmann, 1988). Das soziologische Begriffspaar von Inklusion und Exklusion (Luhmann, 1999) dient dazu, gesellschaftliche Einschluss- bzw. Ausgrenzungsprozesse zu beschreiben, die wegen der häufigen Wechselwirkung von psychischen Störungen mit materieller Verarmung auch einen Großteil der Krisenklientel betreffen kann. Das gesellschaftliche Krisenerleben – trotz gewachsener Wirtschaftsleistung und scheinbar gestiegenem Wohlstand – drückt sich in der gesamten westlichen Welt in nationalistischen und oftmals rassistischen Selbstvergewisserungstendenzen aus. Diese beruhen auf einem »Wir« gegen »die Anderen«, egal ob für die Konstruktion des abgrenzenden »Anderen« Herkunft, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe herangezogen werden (Mecheril, 2018).
Demgegenüber haben die Arbeiten zur Salutogenese (Antonovsky, 1997) und die Resilienzforschung (Werner, 2005; Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006) es vielen Professionellen ermöglicht, von der Defizitorientierung, vom Fokussieren auf die Mängel wegzukommen und stattdessen das Augenmerk darauf zu richten, wie trotz schwieriger Ausgangsbedingungen im Leben vieler Klient*innen deren (Über-)leben gewürdigt und gefördert werden kann. Ansätze der Prävention und des Empowerments bei unterschiedlichen Zielgruppen werden seit der Jahrtausendwende neu formuliert und finden sich in Arbeiten zur Krisenintervention wieder (Herriger, 2006; Lenz & Stark, 2002; Knuf, Osterfeld & Seibert 2007; Neumann, 2009). Der Begriff der Ressourcen hat die wohl stärkste Verbreitung in den Sozialwissenschaften gefunden; kaum ein Konzept möchte noch ohne Ressourcenorientierung auskommen (Schürmann, 2007).
Bereits 1993 hatte der Schweizer Psychiater Luc Ciompi geschrieben: »In den letzten 10–15 Jahren haben sich Krisentheorie und Kriseninterventionspraxis in eine unübersichtliche Vielfalt aufgefächert« (S. 15) Diese Tendenz hat sich die darauffolgenden 25 Jahre später fortgesetzt, sodass es hilfreich ist, zunächst chronologisch die historischen Ausgangsbedingungen der Gründergeneration nachzuvollziehen.