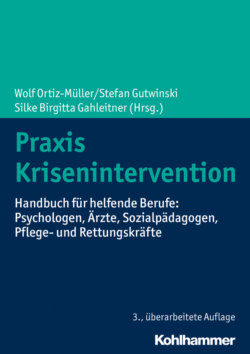Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Krisenbewältigung
ОглавлениеKrisenbewältigung ist ein komplexes Geschehen, das von vielen Einflussgrößen, die in der Person und in ihrem Umfeld begründet liegen, bestimmt wird. Bei der notwendig multifaktoriellen Betrachtung treten die Defizite der linearen Phasenmodelle deutlich zutage. Diese gehen jeweils von einem Auslöser, einem lebensverändernden Ereignis oder traumatischen Erlebnis aus, das auf die Person trifft. Diese reagiere darauf mit Verunsicherung, verstärkten Copingbemühungen, bevor – stark schematisiert – entweder die Lösung, die Neuorientierung oder der Zusammenbruch erfolge. Weitaus angemessener für erfolgreiche Krisenintervention erscheint es jedoch, die Lebensumstände der Person, die mit dem potentiell krisenauslösenden Ereignis konfrontiert wird, genauer und umfassend zu betrachten.
Das Modell veranschaulicht die unterschiedlichen Einflussfaktoren. Der soziokulturell-ökonomischen Kontext ist die leicht zu erfassende äußere Einflussgröße: Das Ereignis trifft auf einen Menschen, der zu diesem Zeitpunkt unter einem Ressourcenmangel leiden oder aber über ausgeprägte externe Ressourcen verfügen kann. Diese finden sich
Abb. 2.6: Einflussfaktoren der Krisenbewältigung
beispielhaft in einem intakten sozialen Umfeld, in der Familie oder bei Freund*innen. Auch kann eine geregelte Lohnarbeit, der Zugang zu Sprache, kultureller Verankerung und Bildung die Person stützen. Ebenso, wenn sie über eine Wohnung und ausreichende Gesundheitsversorgung, ganz allgemein über materielle Sicherheit und geordnete Lebensverhältnisse verfügt. Je größer die vorhandenen Ressourcen, desto gesicherter ist die Basis, ungewohnten Herausforderungen begegnen zu können, ohne aus dem Tritt zu geraten. Meistens jedoch treffen Berater*innen in der Krisenintervention auf Menschen, deren »Säulen der Identität« (Petzold, 2003) wenig Stabilität verheißen.
Die Biographie als Einflussgröße ist von einer Vielzahl an Erfahrungen geprägt, wie Menschen die sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten stellenden Herausforderungen bestanden oder an ihnen gescheitert sind. Konnten ihre Grundbedürfnisse nach Sicherheit und körperlicher Unversehrtheit, nach Bindung und Geborgenheit, nach Teilhabe und Zugehörigkeit, nach Anerkennung und Bestätigung erfüllt werden, so ist eine wichtige Grundlage einer stabilisierenden Resilienz gelegt. Diese bedeutet keine allumfassende Widerstandsfähigkeit, diese muss vielmehr stets als spezifisch und ereignisbezogen verstanden werden. Auf den Verlust der Arbeitsstelle beispielsweise reagiert jemand gelassen, jedoch auf das Zerbrechen der Partnerschaft höchst vulnerabel. Bei einem anderen Menschen kann es gerade umgekehrt sein.
Der Hirnforscher Gerald Hüther (Hüther & Sachsse 2007) spricht davon, dass auf Grundlage erfüllter Grundbedürfnisse solche Metakompetenzen wie Selbstwirksamkeitskonzept, Handlungsplanung, Impulskontrolle, Folgeabschätzung, Frustrationstoleranz ausgeprägt werden können. Diese ermöglichen es einer Person, für kommende Herausforderungen gut gewappnet zu sein: Das psychische »Handwerkszeug« einer problemfokussierenden Auseinandersetzung ist vorhanden und einsetzbar, dennoch ist eine Überforderung der Person bei einem Krisenereignis nie auszuschließen.
Wurden die oben beschriebenen Grundbedürfnisse nicht gewährleistet, weil die Person durch die Erfahrung von Mangel, Vernachlässigung, Diskriminierung oder Gewalt verletzt wurde, so müssen wir von erhöhter Vulnerabilität ausgehen. Eklatante Verletzungen der Grundbedürfnisse können bereits früh zur Ausprägung problematischer Bewältigungsmuster führen. Aus der Verhaltensbiologie kennen wir die Reaktionsschemata von »flight, freeze and fight«, die sich vereinfacht als Flucht oder Vermeidung, als Erstarrung oder Unterwerfung, sowie als Angriff, Überkompensation und Selbstbehauptung auf menschliche Reaktionsschemata übertragen lassen. Grundsätzlich ist mit der Verhaltensbiologie davon auszugehen, dass jeder lebendige Organismus immer auf das beste ihm zur Verfügung stehende Bewältigungsmuster zurückgreift. Einer Bedrohung begegnen die meisten Lebewesen mit einem Fluchtimpuls. Erscheint diese nicht möglich, stellen sie sich der Gefahr durch Selbstbehauptung, Verteidigung und Gegenangriff. Ist auch diese Möglichkeit versperrt, bleibt eine Art des Totstell-Reflexes, der Erstarrung und Unterwerfung unter Aufgabe wesentlicher Bedürfnisse. Diese Grundmuster entsprechen den Erkenntnissen der Neurobiologie und Stressforschung, die von einem Panik- und einem Furchtsystem (Panksepp 2004) ausgehen. Die psychophysiologischen Reaktionen für die Entstehung von Traumata auf hirnorganischer Ebene (Amygdala, Hippocampus) und die zugehörigen Symptomatiken (Intrusionen, Hyperarousal, Vermeidungsverhalten) sind vielfach beschrieben ( Kap. 15 Purtscher-Penz & Penz).
Die Einteilung unterschiedlicher Bewältigungsmuster weist Ähnlichkeiten mit dem Konzept der Über- und Unterstimulierungskrise von Kast (1987) auf. Überstimulierungskrise meint eine Reaktionsweise, die von überschießenden Emotionen und starker Expressivität gegenüber der Umwelt gekennzeichnet ist. Umgekehrt erscheinen als Unterstimulierungskrisen solche, die still und oft unbemerkt verlaufen, weil sich die Menschen als Verarbeitungsreaktion von ihren Gefühlen distanzieren und innerlich erstarren und damit nicht mehr nach außen treten.
Die früh gelernten Bewältigungsmuster können als adaptiv in dem Sinne gelten, dass sie damals einer Person das Überleben gesichert haben. Werden sie jedoch zeitlebens beibehalten, so erweisen sie sich häufig als zunehmend maladaptiv und inadäquat. Neuen Herausforderungen wird dann nicht mit inzwischen erlangten Metakompetenzen von Reflexion, Impulskontrolle und Handlungsplanung begegnet, sondern es werden die verankerten biografischen Schemata zum Beispiel der Hilflosigkeit oder des Ausgeschlossenseins angetriggert. In der Folge werden leicht die alten impulsiven Bewältigungsmuster von Flucht, Vermeidung, Erstarrung oder Überkompensation und Erregung aktiviert. Diese Überlegungen basieren auf dem Modusmodell der Schematherapie als einem integrativen Therapieverfahren, das die aktuelle emotionale Aktivierung (Verletzung, Wut, Verzweiflung etc.) auf die Ausprägung früh erworbener Schemata bezieht (Young, Klosko & Weishaar 2005, Roediger 2011). Entscheidend für die Aktivierung unterschiedlicher Bewältigungsmuster ist die subjektive Bedeutungsgebung (Filipp & Aymanns 2009), die die Person dem Ereignis in einem Kontext zu einem gewissen Zeitpunkt auf dem Hintergrund der erworbenen Vulnerabilitäten bzw. Resilienzen zumisst. Zum typischen Krisenerleben einer Einengung des Denkens, Fühlens und Handelns kommt es dann, wenn die eigenen Copingfähigkeiten in der Spiralbewegung fortgesetzter Situationsbewertungen als unzureichend erscheinen. Krisenbewältigung bedeutet demzufolge, dass in der fortgesetzten Neueinschätzung und Ressourcenaktivierung schließlich die reflektierenden Kompetenzen der Person gegenüber den reflexartig einsetzenden Reaktionsmustern die Oberhand gewinnen, so dass sie wieder ihre Selbstwirksamkeit erfahren kann.
Die Krisenbewältigung hängt ab
• vom auslösenden Ereignis,
• von den dann verfügbaren internen und externen Ressourcen und,
• vom Verhältnis der biographisch erworbenen Resilienz zur eigenen Vulnerabilität.
Das Zusammenwirken dieser Einflussfaktoren und ihre subjektive Bedeutungsgebung bestimmen, ob sich ein Mensch als »in der Krise« erlebt.
Für die Überwindung der Krise sind die Bewältigungsmuster und Copingstrategien ausschlaggebend, die günstigenfalls fortwährend der Situation angepasst werden können.
Diese Bewältigungsmuster unterscheiden sich in der Anpassungsleistung. Sie zielen entweder auf die äußere Realität, die die Person durch eigene Anstrengungen verändern möchte oder es erfolgt eine innere Anpassung der Person an gegebene unveränderbare Umstände. Die damit geleistete Verminderung der »Ist-soll-Diskrepanz« hat zur Folge, dass dieselben anfangs krisenauslösenden Umstände im weiteren Verlauf nicht mehr als krisenhaft bedrohlich erlebt werden. Für den einen ist die Krise des Arbeitsplatzverlustes erst abgewendet, wenn er eine neue Stelle hat, ein anderer findet sich damit ab und lebt unter veränderten, vielleicht eingeschränkten materiellen Bedingungen nicht unzufrieden weiter. Ein Dritter kann seine bedrohliche Krankheit akzeptieren und mit ihr leben, während ein Vierter um seiner Selbstbehauptung willen immer weiterkämpfen muss, und sich dafür in der Krisenintervention Mut und externe Ressourcen holt.
Daraus ergibt sich, dass keine verallgemeinerbaren Kriterien angegeben werden können, woran erfolgreiche Krisenbewältigung festgemacht werden kann. Dross (2001) schreibt dazu:
»Allgemeine Homöostase-Modelle der »Wiederanpassung« sind ebenso wie generelle Vorstellungen über »Wachstum durch die Krise« als erfolgreiche oder »Einmündung in Krankheit« als erfolgloser Krisenlösung zu einfach, um den sehr vielfältigen Ausgängen von Krisengeschehen gerecht zu werden« (S. 19).
So wenig, wie die Forschung universelle Auslöser finden konnte, so wenig lassen sich generell gültige Bewältigungsmuster formulieren. Filipp & Aymanns (2009) konstatieren:
»Das Gelingen der Bewältigung zeigt sich darin, inwieweit die Betroffenen das fragliche Ereignis in einem positiven Licht sehen können, daraus subjektiv einen Gewinn gezogen oder es als Teil ihres Lebens angenommen haben« (S. 19).
Das kann Berater*innen ermutigen, die individuellen Bewältigungsansätze mit Offenheit zu begleiten. Nicht zuletzt sollte die ganz überwiegend positive retrospektive Bewertung der professionellen Krisenhilfe durch ihre Nutzer*innen, stärker wahrgenommen werden (Gastner & Huber, 2007). Mit der Fragestellung, was im Kern geholfen hat, bedarf es weiterer wissenschaftlicher Verlaufsforschung der Krisenarbeit.