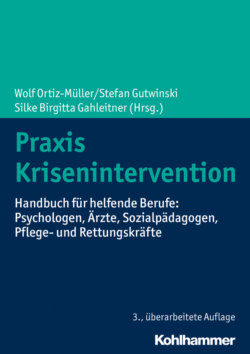Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II Praxis – Mit den Nutzer*innen arbeiten
ОглавлениеDer zweite Teil des Buchs nimmt in 12 Kapiteln besondere Zielgruppen der Krisenintervention in den Fokus. Der Aufbau ermöglicht es den Leser*innen rasch die Spezifika einer Klientel oder eines Settings nachzuschlagen, um ihr Wissen zu vertiefen oder sich für eine Kontaktaufnahme mit vielleicht weniger vertrauten Krisensituationen zu präparieren.
Kapitel 6
Detlev Gagel und Ilse Eichenbrenner skizzieren in ihrem Beitrag Freischwinger oder Wartebank? – Klient*innen zwischen Sozialpsychiatrischem Dienst und Krisendienst die Verbindungen und Übergänge der Krisenintervention, die vom Sozialpsychiatrischen Dienst zum ambulanten Krisendienst bestehen. Hier wie dort wird Krisenintervention betrieben, der jeweilige Auftrag und Rahmen zeigen aber große Unterschiede – die Nutzer*innen auch?
Kapitel 7
Diesen Aspekt greifen Stefanie Schreiter und Stefan Gutwinski aus einer anderen Perspektive auf. Unter dem Titel Wohnungslos und Wohnungsnot – Krisenhilfe aus sozialpsychiatrischer Perspektive geben Sie Einblick in die Welt von Menschen, die aus vielen Netzen herausgefallen sind, die ihren »Ort« verloren haben und für die der Ortswechsel das Konstante ist: Wohnungslose in Krisen. Wie können wir verhindern, dass diese Menschen durch die Maschen des Hilfenetzes zwischen Suchthilfe, sozialpsychiatrischer Hilfe und Wohnungslosenhilfe fallen?
Kapitel 8
Komplexer Problemlagen spielen im Beitrag von Johannes Henssler und Carlos Escalera eine entscheidende Rolle. Eine Krise, die viele Krisen entstehen lässt – Krisenintervention und geistige Behinderung macht deutlich, wie stark die gegenseitige Beeinflussung von Helfer*innensystem und Klient*innen ist und wie sensibel demzufolge interveniert werden muss, um Eskalationen auf beiden Seiten zu vermeiden. Die Autor*innen geben Hinweise, wie Krisen bei Menschen mit geistiger Behinderung erkannt, verstanden und behandelt werden können. Woran erkennen wir, wann es sich bei den Krisenzuständen der geistig Behinderten im Kern um Krisen des Helfersystems handelt? Wie intervenieren wir, um latenter und manifester Gewaltausübung strukturell zu begegnen?
Kapitel 9
Eva Reichelt nennt ihren Beitrag. »Fremde sind wir uns selbst« – Krisenintervention bei Migrant*innen und Geflüchteten, und weist paradigmatisch auf die Unumgänglichkeit der Selbstreflexion der Helfer*innen hin, um das vermeintlich Fremde verstehen zu können. Menschen, die nach Deutschland eingewandert oder geflohen sind, stellen ebenso wie jene, die vielleicht schon in zweiter oder dritter Generation hier leben, besondere Anforderungen an unser Selbstverständnis als Helfer*innen. Wie können sprachliche, aber auch kulturspezifische Besonderheiten hinsichtlich Krankheit, Hilfestellung und Erwartungshaltung berücksichtigt werden?
Kapitel 10
Das Thema der Erreichbarkeit beschäftigt Sigrid Meurer im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. »Eigentlich will ich leben, aber so wie jetzt kann ich nicht mehr weiter« – Krisenintervention bei Kindern und Jugendlichen nennt sie ihren anschaulichen Beitrag, in dem deutlich wird, dass es besondere Angebote geben muss, um Jugendliche zu erreichen und um ihren Krisen gerecht zu werden. Ein großer Schwerpunkt liegt dabei auf der Suizidgefährdung.
Kapitel 11
Burkhard Brückner nähert sich in seinem Beitrag »Alter schützt vor Torheit nicht« – Alterskrisen als Aufgabe der Krisenintervention dem entgegengesetzten Ende der Lebensspanne: Die alten Menschen, die stärker noch als andere Altersgruppen als suizidgefährdet gelten müssen. Eingebunden in das System der Familien oder der Altenhilfe – oder aus beidem herausgefallen – stellt sich die Frage, welche Herangehensweisen sich empfehlen, die den Besonderheiten des Alters gerecht werden.
Kapitel 12
Tomislav Majic und Stefan Gutwinski legen in ihrem Kapitel Krisenintervention bei Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren die Hintergründe für das Entstehen von Substanzgebrauchsstörungen, sowie hilfreiche therapeutische Haltungen im Umgang mit diesen Menschen dar.
Kapitel 13
Unter dem Titel Krisenintervention bei psychotischen Krisen – Was wir von den Skandinaviern lernen können bringt Volkmar Aderhold die Ergebnisse seiner Forschungen und Erfahrung in den deutschen Psychiatrie- und Krisendiskurs ein. Psychosen als eine mögliche Ausprägungsform von Krisen bedürfen sowohl eines spezifischen Umgangs als auch eines außerstationären Settings, um frühzeitig und effektiv unter Einbeziehung des Betroffenen und seines familiären bzw. sozialen Umfelds bearbeitet zu werden und einer Chronifizierung entgegenzuwirken.
Kapitel 14
Claudia Schmitt und Stefan Gutwinski schildern in dem Kapitel Therapeutische Haltungen und unterstützende Interventionen für Menschen in Krisen, die unter einer Borderline Persönlichkeitsstörung leiden ganz konkret mögliche Haltungen und Strategien im Umgang mit Menschen mit Borderline Störungen. Das Kapitel ist aus dem Klinikleitfaden der Psychiatrischen Universitätsklinik im St. Hedwig Krankenhaus entstanden, welcher über Jahre von Psycholog*innen, Pflegekräften, Ärzt*innen Sozialarbeiter*innen und anderen Mitarbeiter*innen entwickelt wurde.
Kapitel 15
Unter dem Titel Krisenintervention nach akuter Traumatisierung führen Katharina Purtscher-Penz und Bernhard Penz in die theoretischen Grundlagen und die Praxis der Akutintervention im Traumabereich ein. Sowohl für betroffene Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche stellen sie sowohl Basiswissen als auch praxisnahe Strategien vor, die helfen, Akutintervention sinnvoll und schonend zu gestalten und Menschen in dieser Situation wieder Hoffnung zu vermitteln.
Kapitel 16
Manuel Rupp widmet sich in seinem Beitrag dem Umgang mit gewalttätigen Patient*innen: Prinzipien der Deeskalation und stellt dabei die Komplexität Opferschaft – Täterschaft und den professionellen Umgang mit diesen hoch belastenden Dynamiken in den Vordergrund.
Kapitel 17
Ein Bereich, der sich extrem rasant weiterentwickelt hat, ist die Krisenberatung im Internet. Petra Risau hat hierfür ihren Beitrag Endlich traue ich mich – Chancen und Herausforderungen der Online-Beratung für Betroffene sexualisierter Gewalt komplett neu überarbeitet. Der Onlinebereich ist ein stark angewachsener Bereich, der die Hilfelandschaft radikal verändert hat und immer weiter verändern wird. Dies hat auch Rückwirkungen auf die Angebote des traditionellen »Face-to-Face-Kontakts«. Ein wichtiger Grund, diesen Entwicklungen nicht hinterherzulaufen, sondern die Relevanz für das eigene Institutionenprofil zu überprüfen.