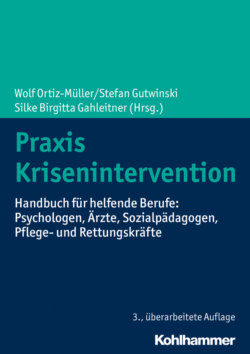Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Der integrative Brückenschlag von George L. Engel
ОглавлениеDie Diskussion um das »medizinische Modell« war jetzt an einem Punkt angelangt, wo sie noch einmal von George L. Engel, einem renommierten amerikanischen Psychiater und Psychosomatiker, resümiert werden konnte. In diesem Artikel wird die reduktionistische Tendenz des traditionellen Krankheitsbegriffs kritisiert und festgehalten, »das den wissenschaftlichen Aufgaben und der sozialen Verantwortung von Medizin« (Engel, 1977/1979, S. 64) nicht mehr gerecht werde. Ausgangspunkt seiner Argumentation war der Begriff Krankheit. Dieser lege »die Grenzen angemessenen professionellen Handelns« (Engel, 1977/1979, S. 64) fest und beeinflusse »die Einstellung zu und den Umgang mit den Patienten« (Engel, 1977/1979, S. 64). Seine Kritik zielt im Kern darauf, dass Krankheit im biomedizinischen Modell nur durch somatische Parameter definiert werde, was in der Konsequenz bedeute, dass bei seiner solchen professionellen Perspektive psychosoziale Probleme ausblendet oder als irrelevant beiseitegelassen würden. Engel (1977/1979) forderte deshalb, dass psychologische, soziale und kulturelle Faktoren besonders berücksichtigt werden sollten. Er erachtete die Lebensumstände als bedeutsame Variable, die den Krankheitsverlauf beeinflussten. Zudem betonte er, dass die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit bei Weitem nicht klar seien und es auch niemals sein könnten, denn sie würden durch kulturelle, soziale und psychologische Erwägungen verwischt. Schon begrifflich wird die Trias zentraler menschlicher Basisbedingungen genannt: Bios, Psyche und Soziales. Dieser Vorschlag entsprach auch den Kooperationsformen zwischen unterschiedlichen Professionen, die sich in der Sozial- und Gemeindepsychiatrie herausbildeten. In den ambulanten sozialpsychiatrischen Einrichtungen wurden Ärzt*innen, Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen zu multiprofessionellen Teams zusammengeführt. Hier ging es nicht mehr um Dominanzkultur eines spezifischen disziplinären Blicks. Vielmehr konnten sich über solides Kooperationswissen aller Beteiligten handlungspraktisch tragfähige gemeinsame Sichtweisen entwickeln. Aus einem dogmatischen »monotheistischen« Störungsverständnis war zunehmend eine tolerante »polytheistische« Perspektive entstanden (vgl. etwa das plurale Spektrum bei Jaeggi, Rohner & Wiedenmann, 1990; oder bei Franke, 2006). Dies lässt sich durchaus auch an der Entwicklung der internationalen Klassifikationssysteme wie ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision: WHO,dt. Ausgabe hrsg. von Dilling et al.2015) oder DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Revision: American Psychiatric Association, 2018) ablesen. Sie konstruieren eine Zusammenschau unterschiedlicher Achsen, wobei nicht nur biologisch-neurologische Fakten, sondern auch entwicklungspsychologische und soziale Kontextbedingungen einbezogen werden. Die frühe Forderung nach mehrfaktoriellen Modellen schien damit erfüllt zu sein.
Hat Engel (1977/1979) mit seinem Vorschlag einen historischen Kompromiss ermöglicht? Auf dem Feld der theoretischen Fechtübungen mag das so gewesen sein. Die Paradigmakontroversen flauten ab, und es zeichneten sich deutlich handlungspragmatische Lösungen ab, in denen die »heiligen Kriege« um die Wahrheit nicht mehr so bedeutsam waren.