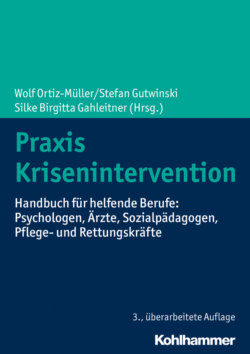Читать книгу Praxis Krisenintervention - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6 Was ist Krise – sozialpsychologisch betrachtet
ОглавлениеMargret Dross (2001) hat eine gut nachvollziehbare Definition von Krise vorgelegt und sagt, dass von einer Krise dann zu sprechen ist, wenn
• »ein Zustand psychischer Belastung eingetreten ist, der sich deutlich von der Normalbefindlichkeit einschließlich ihrer Schwankungen abhebt, als kaum mehr erträglich empfunden wird und zu einer emotionalen Destabilisierung führt,
• die widerfahrenen Ereignisse und Erlebnisse die bisherigen Lebensgewohnheiten und -umstände und die Ziele massiv infrage stellen oder unmöglich machen,
• die veränderte Situation nach Lösungen verlangt, die aber mit den bisher verfügbaren oder selbstverständlichen Möglichkeiten der Problemlösung oder Anpassung nicht bewältigt werden können.« (Dross, 2011. S. 10)
In dieser Begriffsbestimmung wird betont, dass eine Krise dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen aus der Normalität ihrer gewohnten und verlässlichen alltäglichen Selbstverständlichkeiten herausfallen. In diesen Selbstverständlichkeiten bündelt sich unser jeweils erreichtes Balancierungsverhältnis von inneren Welten mit dem, was wir als Realität erleben. In unserer alltäglichen Identitätsarbeit arbeiten wir an dieser Integration oder Passung (vgl. Keupp et al., 1999/2013).
Mit dem Verweis auf ein klassisches sozialwissenschaftliches Experiment möchte ich noch einmal die Bedeutung alltäglicher Routinen und Selbstverständlichkeiten für das herausarbeiten, was wir als »Normalität« bezeichnen könnten. Der nordamerikanische Ethnomethodologe Harold Garfinkel (1967) hat in seinem »Krisenexperiment« auf elegant-einfache und zugleich dramatische Weise gezeigt, wie Krisen auftreten, wenn uns die Basisselbstverständlichkeiten genommen werden. Er schickte seine Student*innen mit dem Auftrag ins Wochenende, sich zu Hause konsequent wie Gäste zu verhalten. Wenn Töchter oder Söhne diese Anweisung konsequent durchhielten, erzeugten sie Krisen in ihren Familien. Diese waren teilweise so heftig, dass besorgte Eltern die psychiatrische Krisenintervention eingeschaltet haben. Wenn eingespielte Regeln und Normen alltäglicher Lebensführung infrage gestellt oder außer Kraft gesetzt werden, beginnt der Boden unter uns zu schwanken. Krisen können durch akute lebensverändernde Ereignisse ausgelöst werden, die für einzelne Personen oder Mikrosysteme die Alltagsnormalitäten gefährden können. Es gibt aber auch Krisen der Normalität selber, wenn sich die Grundlagen eines soziokulturellen Systems so verändern, dass bislang tragfähige Schnittmuster der Lebensgestaltung ihre Tauglichkeit verlieren. In einer solchen »Normalitätskrise« befinden wir uns gegenwärtig, und genau dieses Stichwort soll meine weiteren Überlegungen bestimmen, auf die ich mit der folgenden These vorbereiten möchte:
In seinem klassischen Werk »Das Unbehagen in der Kultur« hat Sigmund Freud (1930) aufgezeigt, dass uns zivilisatorische Absicherungen zwar ein befriedetes Leben bringen können, uns aber auch um unser Glück »betrügen«. Ist das heute noch eine befriedigende Sicht? Ist mit dem Siegeszug der Globalisierung, dem digitalen Kapitalismus und dessen neoliberalem Menschenbild des fitten und ultraflexiblen Subjekts nicht längst der Sicherheitspfad verlassen? Wir leben in einer gesellschaftlichen Periode, in der sich in dramatischer Weise gewohnte Lebens- und Arbeitsformen verändern, ohne dass sich schnell wieder neue Lebensroutinen ausbilden. Diese gesellschaftlichen Veränderungen erleben viele Menschen als Befreiung aus traditionellen Lebensmodellen, sie sehen den gewachsenen Spielraum für die selbstbewusste Gestaltung offener Normalitäts- und Identitätsmodelle. Aber genauso viele Menschen reagieren angstvoll auf den Verlust von gewohnten Lebenskonzepten und Sicherheitsgaranten sowie auf eine ungesicherte Zukunft. Die erlebte Gegenwartsgesellschaft hat für das subjektive Umgehen mit diesen Erfahrungen noch keine »einbettende Kultur« geschaffen, in der das »Handwerk der Freiheit« hätte kollektiv gelernt werden können. Das aktuell hohe »Angstmilieu« ist eine Reaktion darauf.
Normalität heute – im Unterschied zu jener Phase, die als »Postmoderne« bezeichnet wird – ist kein »Freifahrtschein« für Lebenskünstler*innen, die nur noch ihren eigenen kreativen Intuitionen folgen. Auch wenn auf den Identitätsbaustellen nicht mehr nach kulturell normierten Bauplänen gearbeitet wird, herrscht dort kein Reich der Freiheit. Es geht immer noch um Passung zwischen Subjekten und einem globalisierten Netzwerkkapitalismus, und die Identitätsarbeit der Person hat diese Passung zu erbringen. Die »Normalitätsschablonen« haben nicht mehr fixen Normen zu entsprechen, sondern bilden sich einen permanent steigernden Fitness-Parcours. Und »Fitness« bedeutet Affirmation. Und wenn Affirmation zur Normalität wird, ist sie ein »Krisentreiber«.