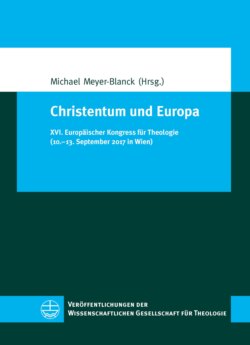Читать книгу Christentum und Europa - Группа авторов - Страница 74
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die christliche Pflege des religionskulturellen Gedächtnisses
ОглавлениеNiemand wird in Abrede stellen, dass das Christentum als religiöse Praxis und theologische Reflexion, als implizites und als explizites Wissen die Wissenskulturen Europas als eines Raumes geteilten Wissens geschichtlich mitgestaltet hat. Man kann freilich meinen, dass diese Aussage trivial sei wegen der langen kulturellen Dominanz der christlichen Kirchen, erst mit dem Ende dieser Dominanz könne sie zur gehaltvollen Feststellung werden. Dieser Meinung möchte ich mit zwei Argumenten widersprechen. Eines betrifft die Eigenart des kollektiven Gedächtnisses im Christentum (2.), das andere die Eigenart der kulturellen Präsenz christlich geprägten Wissens und Handelns (3.).
Nicht strittig dürfte sein, dass das Christentum in allen seinen Praxisformen und in seinen Theologien das religionskulturelle Gedächtnis Europas aufgebaut, durchgängig bearbeitet und mit ihm dieser Region eines ihrer definierenden Merkmale gegeben hat. Diese Arbeit ist freilich selbstverständlich für eine Glaubensgemeinschaft, die auf Erzählungen gründet und die auch im dichtesten Moment göttlicher Präsenz sich an Verheißung erinnert; trotzdem ist sie nicht trivial. Denn, in der Binnen- wie in der Außenperspektive unstrittig, unterschied sich der christliche Weise des Glaubens und Lebens stets auch konstitutiv von den intellektuellen, ethischen und politischen Kulturen, in denen er existierte, verband sich aber zugleich, und zwar aus inneren Gründen seiner Gottesbeziehung, in dieser Weltzeit mit der (geschaffenen) Welt. Auch wenn er in seiner Geschichte die jeweils eigens zu bestimmende Korrelation sehr unterschiedlich realisierte, entwickelte er dennoch langfristig wirksame kulturstrukturelle Differenzierungen. Er prägte Kultur, so könnte man vielleicht sagen, als das Ensemble von »Unterscheidungstexturen«.3 Solche christlich initiierten, aber dann kulturell generalisierten Unterscheidungstexturen sind etwa die von Glauben und Wissen in der intellektuellen, die von Naturrecht und christlichem Ethos in der moralischen und die von religiöser Autorität und gesellschaftlicher Sanktionsmacht in der politischen Kultur.
Der christlichen Wissenskultur ist es daher wesentlich, ins eigene Wissen auch anderes Wissen als anderes zu inkorporieren: etwa jüdisches religiöses und weisheitliches Wissen, griechisch-philosophisches Wissen und römisch-juridisches Wissen. Die Theologie bezog und bezieht sich dem entsprechend immer auf den biblischen und christlichen interpretierten Kanon und zugleich, und zwar iterierend, auf heterogenes Wissen. Sie nahm und nimmt immer zugleich eine Binnenperspektive auf sich selbst ein und nimmt Außenperspektiven auf sich wahr, die sie auf hermeneutisch unterschiedlichen Wegen in sich selbst zur Wirkung bringt. Das deshalb komplex sich entwickelnde christlich-religionskulturelle Gedächtnis konnte daher zeitweise die Rolle des gesamtkulturellen Gedächtnisses Europas einnehmen – allerdings um den Preis der Entschärfung der strukturell mitgeführten Differenz. Das war der Fall in den Jahrhunderten, in denen das christliche Glaubenswissen normativer Rahmen auch der auf Erfahrung und Vernunft basierenden Philosophie war; in dem also die Theologie bestimmte, was legitimerweise als philosophische Probleme gelten konnte, und überdies verbürgte, dass die Weltgeschichte einschließlich ihrer Denkgeschichte mit der biblischen Heilsgeschichte synchron verlief.
Trotzdem wurde die christliche Wissenskultur niemals die Instanz homogener Kohärenz alles Gewussten: Sie war kraft ihrer Herkunft aus verschiedenen Wissenskomplexen, kraft ihrer Selbstunterscheidung vom Politischen und kraft ihrer Erwartungshaltung im Blick auf die erst zukünftige Vollendung mit Alterität imprägniert. Die darin liegende, durchaus auch als Defizit empfundene Unruhe löste eine ambivalente Dynamik aus, die zu starken mentalen Identifikationen und sozialen Kohärenzbildungen führte, aber ebenso – und seit der Frühen Neuzeit zunehmend – zu mentalen Pluralisierungen, sozialen Verwerfungen, politischen Konflikten und doktrinären Diskrepanzen. Die christliche Wissenskultur war in synchroner und diachroner Erstreckung eine stets auch in Differenzen und Ambivalenzen bewegte, jedenfalls keine identitäre Größe. Man kann idealiter sagen, dass christliches Wissen und Können die Nichtlinearität geschichtlicher Kausalität steigert, weil es die Differenz der Perspektiven nicht identitär auflöst – bei Strafe sektenhafter Regression nicht auflösen kann.
Realiter ist das Bild weniger erfreulich, nicht nur in den eben angesprochenen alten Zeiten, sondern auch in den Jahrhunderten des konfessionellen Christentums. Bis heute fehlt es nicht an immer wieder erfolgreichen Tendenzen, die konstitutive innere Differenzstruktur des Christentums zu externalisieren. Das geschah und geschieht teils aus Fahrlässigkeit, teils der Not gehorchend, teils kirchenregimentlich absichtlich zum vermeinten Nutzen der Kirche. In einer solchen Gemengelage der Motive bewegte sich auch die Wissenskultur der frühneuzeitlichen Reformationen; die in Aufklärung und Moderne fortgehende Reformation vermochte sich auch nicht völlig aus der identifikatorischen Logik der Symmetrie von Einschluss und Ausschluss des Anderen zu lösen. Die Reformation des 16. Jahrhunderts hat trotz ihres humanistischen ›Bildungspathos‹ das zuvor bestehende Wissensregime nicht einfach beendet. Selbst die Melanchthon‘sche Korrelation von Wissen und Glauben, die der theoretischen Neugierde in Gestalt der libertas philosophica mehr Spielraum ließ,4 hat nicht verhindert, dass Luthers christologische These von der doppelten Wahrheit bei manchen Theologen schon des 16. Jahrhunderts generalisiert und in ein axiomatisches Regime des Offenbarungswissens transformiert wurde.
In einer ersten Skizze meines Vortrags folgte hier der Satz:
»Auch wenn Spätfolgen der Aufblähung der christlichen Wissenskultur zum Herrschaftswissen bis heute in Europa auftreten und im Fundamentalismus das Glaubenswissen selbst korrumpieren, ist es dem europäischen Christentum in einem schmerzlichen Prozess der Selbstaufklärung doch einigermaßen gelungen, sich seines originären Charakters als Differenzkultur zu besinnen.«
Eine solche pauschale These, Ernst Troeltsch in Ehren, ist leider nicht zu bewahrheiten, auch nicht mit der Annahme weiterer Aufklärung. Auch innerhalb des protestantischen Christentums in Europa kann von einer Kultur des Differenzwissens und der entsprechend begründeten Alteritätstoleranz vielfach noch nicht, teils sogar: nicht mehr die Rede sein, und wo das der Fall ist, gilt die akademisch etablierte Theologie nicht ohne Weiteres als Lösung, sondern oft als Teil des Problems. Immer wieder begegnen einem ernste Äußerungen des Misstrauens auch bei Mitgliedern einer evangelischen Kirche, die der Theologie mangelnde Aufmerksamkeit oder Entschlossenheit in dieser Hinsicht vorwerfen. Ich muss gestehen, dass mich solche Äußerungen nicht unberührt lassen.
Das ist besonders dann der Fall, wenn sie die noch bestehenden staatskirchenähnlichen Strukturen besonders in Deutschland ansprechen, die allseitige Affirmationswilligkeit der öffentlichen Theologie beklagen und nach dem kritischen Impetus der klaren Unterscheidung von Gott und »Kaiser« respektive Gott und »Mammon« fragen. Als Problem angesehen wird oft auch die theologische Milde gegenüber der sich vertiefenden Diskrepanz zwischen rechts- und verwaltungsförmiger Institution und dem religiösen Geist – man kann in der Tat nicht ignorieren, dass die fromme Spiritualität vermehrt aus der volkskirchlichen Praxis in fluide freie Assoziationen oder in spektakuläre Events als der besseren Erlebnisform des Christentums auswandert. Besonders belastend für einen systematischen Theologen ist die zwar nie beabsichtigte, aber faktisch inzwischen weitgehend eingetretene Externalisierung dessen, was eine Zeitlang »Volksfrömmigkeit« hieß und heutzutage als mehr oder weniger frei auch unter Christinnen und Christen flottierende synkretistisch-heterodoxe »Esoterik« existiert. Theologie, in deren Wissen der sensus fidelium in der Autoritätenhierarchie, dem reformatorischen Schriftprinzip entsprechend, sehr weit oben rangieren sollte, kann sich da nicht mit dem Hinweis auf den allgemein beklagten (und gewiss vielfach verursachten) Abbruch kultureller Traditionen beruhigen. Angesichts der Abspaltung des offiziellen Glaubenswissens vom faktischen Glaubenswissen (auch und gerade bei ökumenisch engagierten Christen) macht die der Theologie aufgetragene Pflege des religionskulturellen Gedächtnisses uns, den Erben der frommen Aufklärung, eine alte Aufgabe neu dringlich. Deren negativer Aspekt ist, der Versuchung zu widerstehen, die ihrem Wissen unruhestiftend eingelagerte Alterität identitär zu bereinigen; was nicht nur historiographischen, sondern auch systematischen und religionshermeneutischen Mut erfordert. Positiv besteht die Aufgabe darin, eine in der je aktuellen religiösen Situation wirksame Balance zwischen identifikatorischer Eingrenzung und pluralisierender Öffnung des kulturellen Horizonts des Christentums auszumitteln. Die Buntheit und sozusagen Unreinheit seines religionskulturellen Habitus ist eine wesentliche Voraussetzung seiner spezifischen Entwicklungsdynamik, einschließlich der darin erzeugten Ambivalenzen.
Solche Ambivalenzen zu erfassen und zu bearbeiten, ist eine schwierige Aufgabe, weil in ihnen das jeweilige theologische Wissen auf komplexe und irritierende Weise mit der jeweils umgebenden Wissenskultur verflochten und dabei auch verfremdet wird, ja sein Anspruch auf Sinn ins Gegenteil verkehrt werden kann. Auf jeden Fall wirken wissenskulturelle Folgen des Christentums auf dieses auch – wiederum religiös ambivalent – zurück. Ein aktuelles Beispiel sind die ethisch-politischen Irritationen, die von der vermuteten Verbindung des menschenrechtlichen Universalismus der westlichen Welt mit dem biblisch-naturrechtlichen Ethos ausgelöst werden. Weniger spektakulär, aber umso folgenreicher ist die ambivalente Präsenz des ursprünglich in der heilsgeschichtlichen Apokalyptik platzierten Chiliasmus in dessen weltanschaulicher, auch säkular sich gebender Transformation. So bestimmt er das gesellschaftliche Handeln in den westlichen Ländern tiefgreifend, zwischen der Erwartung des fortwährenden zivilisatorischen Fortschritts (sei es als Realisierung des ›Jenseits‹ im Diesseits, sei es als Verdammtseins zu ökonomischem Wachstum) und dem alltäglichen Zeitmanagement. Den theologischen Umgang damit kann man noch kaum als gelungen bezeichnen, vor allem weil hier das heilsgeschichtliche Paradigma meist konventionell und vermeintlich rahmengebend, aber mit geringem eschatologischem Gehalt weitergeführt wird. So bleibt die Distanzierung von millenaristisch-apokalyptischen Fahrplänen der vermeintlich Bibeltreuen unglaubwürdig; die Beziehung christlicher Ethik zu der von der Heilsgeschichte entkoppelten Zivilisationsgeschichte rückt ins Zwielicht.5
Eine Theologie, die die Genealogie der Ambivalenzen in der iterierenden Wechselwirkung von Glaubenswissen und Wissenskultur nicht erklären und ihre Fixierung in Dogmatismen nicht verhindern will, muss mit erheblichem Vertrauensverlust rechnen. Dass es bei solchen Halbherzigkeiten nicht bleiben muss, zeigt überzeugend etwa die neuere Arbeit an der Aufgabe, die sich mit der Ablösung der Naturwissenschaften vom biblischen Naturwissen gestellt hat: das religiös relevante Naturverhältnis der biblischen Texte wahrzunehmen und in unsere praktischen Naturverhältnisse einzubringen suchen, d. h. eine christliche Ökologie auszuarbeiten. Auch der ökumenische und der interreligiöse Dialog ist neuestens ein Feld, auf dem die christliche Wissenskultur sich als Differenzierungskunst bewährt. Die Intelligenz, die hier kommunikativ aufgebaut und als Gebot religiöser Toleranz praktisch wird, kommt dem Ziel näher, die Unhintergehbarkeit der eigenen Glaubensüberzeugung mit dem Respekt vor fremdem Glaubenswissen nichtlinear und nichthierarchisch zu verknüpfen und sogar im christologischen Glutkern der theologischen Wissenskultur zu plausibilieren.