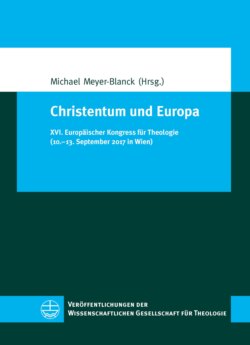Читать книгу Christentum und Europa - Группа авторов - Страница 79
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Zur Gesprächssituation
ОглавлениеDie Gesprächssituation, von der ich im Folgenden ausgehe, ist exemplarisch auf das Verhältnis zwischen Theologie, Philosophie, Psychologie und Medizin bezogen, weil mir diese Konstellation seit mehreren Jahren im Kontext meiner Tätigkeit am Center for Subjectivity Research in Kopenhagen, der Tätigkeit als EU-Gutachterin und in dem seit 2014 laufenden Projekt »Resilienz in Religion und Spiritualität. Aushalten und Gestalten von Ohnmacht, Angst und Sorge«17 vertraut ist. In diesem Kontext geht es mir weniger um eine prinzipielle als um eine pragmatische Umgangsweise mit möglichen Konflikten und Kooperationsmöglichkeiten.
Dass interdisziplinäre und internationale Forschungsprojekte erstens immer dann gelingen, wenn zwischen den beteiligten Forscherpersönlichkeiten die »Chemie« so stimmt, dass sie sich auf eine gemeinsame Sachproblematik konzentrieren können, ist eine Binsenweisheit. Dessen ungeachtet ist die wissenschaftstheoretische Frage interessant, weshalb freundschaftliche Verbundenheit so leicht die ansonsten als grundsätzlich empfundenen Differenzen in der Methodik, die disziplinspezifischen und national differenten Habitus und Usancen sowie die Anspruchs- und Geltungslogiken aufheben können. Wären diese Differenzen so prinzipiell gültig wie in konflikthaften Forschungskonstellationen häufig artikuliert wird, könnte das freundschaftliche wechselseitige Entgegenkommen ja nur um den Preis eines Verlusts an Präzision erfolgen. Der Grund liegt schlicht darin, dass allgemein und/oder kontrovers gehaltene Verhältnisbestimmungen der Theologie und der Naturwissenschaften selten über allgemeine Erwartungen und Unterstellungen positiver wie negativer Art hinauskommen (und daher verzichtbar sind), während das konkrete Forschungsproblem von vornherein die gemeinsame Fokussierung ins Zentrum stellt, an der sich vor allem selbstreflexiv lernen lässt, wie sehr die eigene methodische Zugriffsweise von blinden Flecken durchsetzt ist. So hat sich z. B. in unserem Resilienzprojekt gezeigt, dass die in den gängigen medizinischen Anamnesebögen enthaltenen Fragen zur Bedeutung von Religion und Spiritualität diese Begriffe zwar selbstverständlich und wertschätzend nennen, sie aber in keiner Hinsicht spezifizieren und damit kaum in der Lage sind, Resilienz-förderliche und Resilienzhinderliche Komponenten von Religion und Spiritualität in eine exakte Kriteriologie zu überführen; ebenso dass die gerade in psychisch bedingten Konflikten höchst relevanten Empfindungen des Ausgeliefertseins und Thematisierungen von Negativität wie deren gegenläufige Hoffnungsfiguren zutiefst durch christlich-religiöse Motive bestimmt sind, der Versuch ihrer Erhebung in den Fragebögen aber ins Leere geht, weil weder die behandelnden Ärztinnen noch die Patienten genauer sagen könnten, wovon sie eigentlich sprechen.
Zweitens entstehen die besten interdisziplinären Forschungsprojekte deshalb dort, wo die Sachfrage zu Intersektionalitäten führt, die das wechselseitige Interesse an der Forschung der anderen wachruft. Auch das ist für viele längst eine Binsenweisheit, besonders in der Exegese. In der Systematik halte ich für besonders gelungene Beispiele z. B. die von Markus Kleinert und Heiko Schulz herausgegebene Würdigung der Religionsphilosophie Hermann Deusers, auch wenn die Beiträge noch im innertheologischen Gespräch bleiben; für den interdisziplinären Diskurs sodann die von Stephan Schaede u. a. herausgegebenen drei Bände zum Stichwort »Leben«, auch Elisabeth Gräb-Schmidts Kooperationsprojekt zum Naturbegriff, Dirk Evers’ AG Naturphilosophie oder den von Matthias Petzoldt 2012 herausgegebenen Band »Theologie im Gespräch mit empirischen Wissenschaften«.18 Freilich gelangt man zur Einsicht in die Intersektionalität zuweilen mehr oder weniger durch Zufall oder äußeren Druck. Das lässt sich ablesen an der Entwicklung der Antragsvorgaben in den Forschungsprogrammen der European Commission für die Forschungsrahmenprogramme frp 6, frp 7 und Horizon 2020. Das frp 6 war dominant auf die Qualität der Forschungsziele (»research objectives«), die Methodik und deren Innovationspotential sowie auf die Qualität der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konzentriert, während man Aspekte der Durchführbarkeit, des Transfers und der Communication/Distribution eher nebenbei zu beantworten hatte. Im frp 7 kam hinzu die deutlich stärkere Akzentuierung der Aspekte Implementation, Transfer und Communication/Distribution, um die Chancen für internationale Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit besser bewerten zu können. Mit Horizon 2020 wird inzwischen auch die Durchführbarkeit zu einem zentralen Kriterium erhoben, und zwar vor allem bezüglich der faktischen Interaktion mit den Forschergruppen vor Ort. Konnte man die Kooperation früher einfach als gegeben postulieren, hat man sich jetzt der simplen, aber entlarvenden Frage zu stellen: »Wie machen wir das eigentlich genau – und zwar im Detail genau, wenn wir zusammenarbeiten? Was ist bereits erprobt, was ist geplant, wo liegen Risikofaktoren?« Wo diese Fragen exakt beantwortet werden können, werden Intersektionalitäten sichtbar, die erst das wahrhaft innovative Potential des Forschungsthemas zeigen – und zwar so, dass dessen Qualität in den ansonsten durchaus konfliktfreudigen Gutachtergruppen quer durch die Disziplinen hinweg ein einstimmiges Votum hervorruft. So sehr der Gutachterstreit sonst auch tobt: Vor einem solcherart detailliert ausgeführten Forschungsantrag treten Fach-, Schul- und Interessenskonflikte verblüffend schlagartig zurück hinter den gemeinsamen Respekt gegenüber dem Projekt.
Zu den komplexeren methodischen Differenzen, die in solchen Anträgen wie überhaupt in international und interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsgruppen verhandelt werden, gehört drittens das Verhältnis von Analytik, Hermeneutik und Empirie unter den Vorzeichen der Geisteswissenschaften einerseits und Modellen der Operationalisierbarkeit unter den Vorzeichen der Naturwissenschaften andererseits. Systematisch-theologische und (religions-) philosophische Theoreme und Begründungen hören sich in unserer eigenen Lesart so lange völlig überzeugend an, bis sich von Seiten der empirisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen die kleine, aber ganz und gar nicht harmlose Frage stellt: »Und wie lässt sich das operationalisieren?« Das ist meist der Augenblick, in dem das Gespräch in einer gewissen Ratlosigkeit stagniert, weil methodische Kategorien aufeinandertreffen, die sich nur mit großer Mühe und mithilfe einer hochkonzentrierten gemeinsamen Fokussierung auf das zu lösende Sachproblem bearbeiten lassen. In unserem Resilienzprojekt hat sich dies z. B. an der Schnittstelle zwischen der exegetischen Analyse der Klagepsalmen, der systematisch-theologischen Reflexion von Negativität und Absolutem und deren Integration in operationalisierbare psychotherapeutische Anamnesekategorien gezeigt – drei Zugangsweisen, die methodisch wie sachlich vollkommen disparat sind und dennoch in ihrem Ineinanderwirken für Modi des Aushaltens und Gestaltens von Krisenerfahrungen von höchster Relevanz sind. Es ist nicht nur der jeweils gelernte Methodenkanon, der hier in Frage steht (z. B. wenn ein Forschungsantrag ohne Längsschnittstudie aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht förderbar scheint), sondern die Fähigkeit der Methodenreflexion mitsamt der Abwägung disziplinspezifischer Standards. Für den europäischen Kontext kommt erschwerend hinzu, dass wir zwar einerseits aus einer eindrucksvollen gesamteuropäischen Geistes- und Wissenschaftsgeschichte herkommen,19 andererseits aber die disziplin- und schulspezifischen Differenzen zu enormen Verständigungsschwierigkeiten führen. Während z. B. der Rekurs auf die klassische deutsche Philosophie für unsere Gesprächskultur ungeachtet der Positionierung und des Kenntnisgrades selbstverständlich ist, ist diese in den an der anglo-amerikanischen Tradition ausgerichteten Ländern oft von vornherein mit einem Verdikt belegt und durch Vertreter der analytischen Philosophie ersetzt; Ähnliches gilt z. B. für weite Teile der nordischen Länder, die zwar bei ihren theologieaffinen Vertreterinnen und Vertretern mit der deutschen Tradition eng vertraut sind, in den theologieferneren Bereichen aber eher die französische Philosophie samt deren (widersprüchliche) Aversion gegenüber der Linie von Kant bis Hegel rezipiert haben.