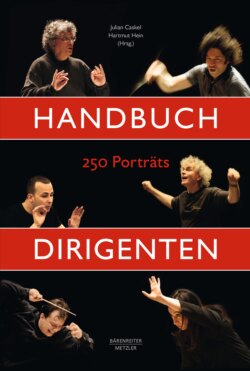Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 13
|55| Abbado, Claudio
Оглавление1933 am 26. Juni in Mailand geboren als Sohn des Violinisten Michelangelo Abbado und der Schriftstellerin Maria Carmela Savagnone. Er ist der Onkel des Dirigenten Roberto Abbado.
1949 beginnt er sein Studium am Mailänder Konservatorium (u. a. bei Antonino Votto), das er in Klavier (1953), Orchesterleitung und Komposition (1955) mit Diplom abschließt. Anschließend setzt er seine Studien bei Hans Swarowsky in Wien fort. Durch das Mitsingen im Chor des Musikvereins (zusammen mit seinem Studienfreund Zubin Mehta) kann er die Probenarbeit zahlreicher Dirigenten mitverfolgen.
1958 gewinnt er in Tanglewood den Koussevitzky-Preis, ebenso ist er im Jahr 1963 (zusammen mit u. a. Zdeněk Košler) Preisträger beim New Yorker Mitropoulos-Wettbewerb.
1961–1963 hat er eine Dozentenstelle für Kammermusik am Konservatorium in Parma.
1965 dirigiert er die Wiener Philharmoniker (WPh) auf Einladung Herbert von Karajans bei den Salzburger Festspielen in Mahlers 2. Sinfonie. Das Konzert gilt als entscheidender Durchbruch Abbados.
1968 Debüt mit Verdis Don Carlo am Royal Opera House, Covent Garden.
1968–1986 ist er (mit verschiedenen offiziellen Positionen und zeitweiligen Amtsniederlegungen) als leitender Dirigent an der Mailänder Scala tätig. Er öffnet das Haus für das zeitgenössische Repertoire und etabliert ab 1982 das Orchestra Filarmonica della Scala.
1973 setzt er sich zusammen mit dem Komponisten Luigi Nono und dem Pianisten Maurizio Pollini in Reggio Emilia mit »Musica / Realtà« benannten Konzertserien für Neue Musik ein.
1978 Gründung des European Community Youth Orchestra, aus dem ab 1981 das Chamber Orchestra of Europe (COE) hervorgeht, das nicht nur mit Abbado, sondern u. a. mit Nikolaus Harnoncourt wichtige sinfonische Zyklen einspielen wird.
1979–1987 leitet er das London Symphony Orchestra, dem er zuvor als Erster Gastdirigent verbunden war.
1982–1985 ist er Erster Gastdirigent des Chicago Symphony Orchestra.
1984 leitet er die Uraufführung von Luigi Nonos Prometeo. Tragedia dell’ascolto in Venedig.
1986 wechselt er als Musikdirektor an die Wiener Staatsoper (bis 1991), wo er mit dem Festival Wien Modern und dem Gustav Mahler Jugendorchester (GM JO) bleibende Initiativen setzt.
1989 gilt seine Wahl am 8. Oktober zum Nachfolger Herbert von Karajans bei den Berliner Philharmonikern (BPh) als Sensation, da andere Kandidaten durch den florierenden Tonträgermarkt stärker protegiert scheinen.
1990–2002 leitet er die Berliner Philharmoniker, lehnt eine Vertragsverlängerung aber bereits 1998 ab. Mit dem Orchester etabliert er thematische Zyklen, die jede Saison um ein einzelnes Sujet zentriert sind.
1994 übernimmt er auch die künstlerische Leitung der Salzburger Osterfestspiele.
2000 muss er wegen einer Krebserkrankung pausieren, bestreitet aber dennoch mit seinem Berliner Orchester eine Japantournee.
2003 begründet er das Lucerne Festival Orchestra, mit dem er fortan alljährlich musiziert. Den Kern des Orchesters bildet das Mahler Chamber Orchestra, zu dem sich berühmte Solisten an den ersten Pulten gesellen.
2004 etabliert er zudem in Bologna das Orchestra Mozart.
2013 wird er in Italien zum Senator auf Lebenszeit ernannt (zuvor erhält er im Jahr 1994 den Ernst von Siemens Musikpreis und im Jahr 2002 das Bundesverdienstkreuz).
2014 stirbt er am 20. Januar in Bologna.
Robert Schumann hat einmal in einer berühmt gewordenen Verwechslung angenommen, die Schottische sei eigentlich die Italienische Sinfonie Mendelssohns. Dieser Fehler wäre ihm bei einer Beschreibung von Claudio Abbado sicher nicht unterlaufen – trotz Abbados eher asketischer Statur und bisweilen »unitalienisch« wortkarger Natur. Zu unverwechselbar erscheinen viele Züge seines Dirigierens: die scheinbar leicht unterkontrollierte Probenarbeit, in der Abbado in verschiedenen Sprachen das Musizieren immer wieder an die beiden Worte »zuhören« und »zusammen« anbindet; die Konzerte, in denen die eingeforderte Spontaneität in der Unabhängigkeit seiner linken Hand und den mitzitternden Mundwinkeln sichtbar wird; die Karriere, in der Abbado Renommierensembles und neu begründete Jugendorchester zueinander durchlässig hält, wie auch seine Diskografie zahlreiche Repertoirezyklen neben anspruchsvollste Neue Musik stellt (nicht zuletzt seines Freundes Luigi Nono).
Doch Abbados Londoner Einspielung der Schottischen Sinfonie aus dem Jahr 1984 wirkt beinahe wie eine nachträgliche Rechtfertigung |56| für Schumanns Verwechslung: Die nebelhafte Einleitung nimmt er mit unerwartet vollem Klang, das Hauptthema dagegen sehr verhalten, sodass bereits in den Anfangstakten die spätere Integration der Finale-Coda vorbereitet wird. Dazwischen entfaltet sich nicht nur im Scherzo eine Kombination virtuoser Motorik und detailgenauer Leichtigkeit, die in der Summe eine der schönsten Ouvertüren ergibt, die Rossini nie geschrieben hat. Eine derartige »Italianità« erlebt man auch in Dvořáks Othello-Ouvertüre, in der die stark profilierten Basslinien an die Sturmszene aus Verdis Oper erinnern. Eine solche Herangehensweise ist aber für Abbado keinesfalls immer typisch und bleibt eingebettet in Attribute eines kammermusikalischen Klangbilds. Ein erstes »Opfer« solcher Analytik ist Lady Macbeth: Im Vergleich mit Riccardo Mutis im selben Jahr entstandener Londoner Aufnahme – das persönliche Verhältnis der beiden wurde bisweilen ebenso zum Shakespeare’schen Königsdrama stilisiert – scheint tatsächlich schon in den ersten paar Takten alles entschieden. Muti dirigiert den »affektiven« Gehalt der ostinaten Rhythmen, die so schon im Vorspiel die folgende Hexenszene abbilden, Abbado eher deren »effektiven« Gehalt – noch näher an der Notation, aber auch etwas neutraler. Die Handlung des Macbeth wird bei Muti zur Schaueroper, bei Abbado hingegen sozusagen zur »Zuschaueroper«, indem die vielen Dreiklänge, die oft als unpassend zum Sujet empfunden wurden, wie unbeteiligte Beobachter wirken, die zur Szene immer etwas Distanz bewahren.
In der großen Masse seiner Aufnahmen vor allem der 1980er-Jahre dominiert jedoch ein manchmal auch leicht unpersönlicher Kompromissklang aus Karajan und Kammerorchester. Abbados multiple Versionen einzelner Mahler-Sinfonien bilden nicht eine gleichbleibende individuelle Stilistik ab, sondern die Anpassung an den jeweils spezifischen Orchesterklang und die Übernahme der gerade zeitaktuellen Trends der Tempogestaltung (das Adagietto der 5. Sinfonie ist in der späteren Berliner Einspielung rund drei Minuten rascher). Wieder reichen die Anfangstakte der Auferstehungssinfonie aus, um das Bild von Abbado als striktem Analytiker auch infrage zu stellen: Die von Mahler vorgesehene Kontrastierung zweier stark voneinander abweichender Tempi wird weder in der Aufnahme aus Chicago umgesetzt noch in den späteren aus Wien und Luzern, die einzelne schroffe Momente in einem schmelzenden Klangbild bewahren (was in Chicago noch genau umgekehrt war).
Abbados Persönlichkeit verbindet im Grunde einen weisen alten Mann und einen schalkhaft unernsten Jugendlichen, während ihm die Attitüden des seriös-kommerziellen Erwachsenen wenig zu bedeuten schienen. Eigentlich hat Abbado die allerletzten leisen Zweifel am Erfolg seiner Berliner Jahre nicht in Berlin, sondern erst danach in Luzern ausräumen können: Diese Luzerner Jahre stellen ein »vergeistigtes Spätwerk« dar, das sich mit demjenigen aller großen Komponisten messen kann – vielleicht auch, weil Abbado hier nun mit einem Orchester arbeitet, das sich umgekehrt immer seinen Wünschen anzuschmiegen hat. Abbados »Spätstil« beginnt aber bereits mit seinem zweiten Beethoven Zyklus (der erste entsteht Ende der 1980er Jahre in Wien, der zweite ab 1999 in Berlin). Im Abgleich mit Leonard Bernstein und Simon Rattle, die jeweils ein Jahrzehnt vor und nach Abbado ebenfalls einen »Wiener« Zyklus produzierten, zielt vor allem Abbados »Berliner« Zyklus nicht darauf, unerwartete interpretatorische Entscheidungen hörbar zu machen, sondern eher darauf, genau diese Entscheidungen zu verbergen. Die Aufnahmen verbinden einen schlanken Klang mit einer ruhigen und traditionellen Klangauffassung: So wird die 5. Sinfonie von der stark wechselnden Länge der jeweiligen Legatobögen her gedeutet, wodurch das »Schicksalsmotiv« beständig in neuen Phrasierungskontexten einsetzen kann. In den Luzerner Konzerten etabliert sich Abbado auch endgültig als der erste und eigentliche Dirigent des DVD-Zeitalters: Wovon Karajan immer nur träumte, das gelingt Abbado ganz mühelos, nämlich die visuelle Präsenz des |57| Dirigenten als unverzichtbar empfundene Komponente des Konzerterlebnisses zu vermitteln.
Abbado besitzt eine unnachahmliche Fähigkeit, im »Laut« das »Leise« zu bewahren, und gerade darum bleibt er ein Spezialist für den archetypischen sinfonischen Weg vom »Leise« zum »Laut«. Musikhistorisch stellt sich dies wohl so dar: Die langsame Einleitung wird in der Geschichte der Sinfonie von der Einwegzur Mehrwegverpackung; die geheimnisvollen Ruinen und Fanfaren, die leise etabliert werden, können dadurch auch noch die lauten Schlüsse grundieren. Bei Abbado hören sich diese großen Feiermusiken der Romantik immer etwas an wie der verträumte Jüngling, der abwesend dabeisitzt und das Fest später literarisch verewigen wird. Dies gilt im Kleinen für den Mittelteil der »Fêtes« aus Debussys Nocturnes, den Abbado in einer Kindheitserinnerung als Initialzündung seines Dirigierwunsches angegeben hat und der noch in seiner Berliner Aufnahme ungewöhnlich leise beginnt und ungewöhnlich laut endet. Es gilt aber auch für den Gesamtverlauf von Schumanns 2. Sinfonie: Die Anfangstakte kombinieren zwei Urtypen der langsamen Einleitung, die Fanfare und die »Nebelmusik«. Dies nutzt Abbado, um bis in das Finale hinein alle Zitate dieser Fanfare durch eine gleichzeitige Reminiszenz an die Nebelschleier abzutönen.
Claudio Abbado war immer auch ein Dirigent für Leute, die Dirigenten nicht mögen. Er hat das charismatische Bild des Berufsstandes so modifiziert, dass eine jüngere Generation sich sowohl in ihrem Bemühen um etwas weniger offenkundig äußerliches Machtgehabe wie in den bewahrten Spielräumen für Eitelkeit, Eigenwilligkeit und Ehrgeiz an Abbado ausrichten kann. Abbado steht nicht nur alphabetisch zu Recht ganz am Anfang jeder Kompilation großer Dirigentennamen – mit Abbado als »Anfangstakt« muss man sich auch um die Zukunft des Dirigierens keine Sorgen machen.
Tonträger
1969 Bruckner: Sinfonie Nr. 1 [Linzer Fassung, 1866] (WPh; Decca) 1976 Verdi: Macbeth (Cappuccilli, Verrett, Domingo, Teatro alla Scala; DGG) 1977 Bartók: Klavierkonzerte Nr. 1 & 2 (Maurizio Pollini, Chicago SO; DGG) 1977/79 Prokofjew: Skythische Suite / Leutnant-Kije-Suite / Alexander Nevsky (Elena Obraztsova, Chicago SO, London SO & Chorus; DGG) 1984/85 Mendelssohn: Sinfonien Nr. 1–5 (London SO; DGG) 1986 Schubert: Messe Es-Dur D 950 (Mattila, Lipovšek, Hadley, Pita, Holl, Wiener Staatsopernchor, WPh; DGG) 1989 Rossini: Ouvertüren: Il barbiere di Siviglia / Semiramide / L’italiana in Algeri / Guillaume Tell / La gazza ladra etc. (COE; DGG) 1992 Nono: Il canto sospeso / Mahler: Kindertotenlieder etc. (Ganz, Lothar, Bonney, Otto, Torzewski, Lipovšek, Rundfunkchor Berlin, BPh; Sony) 1993 Mussorgsky: Boris Godunow [Fassung 1872] (Kotcherga, Larin, Lipovšek, Slovak Philharmonic Chorus Bratislava, Rundfunkchor Berlin, BPh; Sony) 1994 Mozart: Le nozze di Figaro (Gallo, McNair, Skovhus, Studer, Bartoli, WPh; DGG) 1994 Kurtág: Grabstein für Stephan / Stele / Stockhausen: Gruppen (Ruck, Goldman, Creed, BPh; DGG) 1997 Dvořák: Sinfonie Nr. 9 »Aus der Neuen Welt« / Othello (BPh; DGG) 1999/2000 Beethoven: Sinfonien Nr. 1–9 (BPh; DGG) 2010 Berg / Beethoven: Violinkonzerte (Isabelle Faust, Orchestra Mozart; HMF) 2012 Schumann: Sinfonie Nr. 2 / Ouvertüren: Manfred / Genoveva (Orchestra Mozart; DGG)
Bildmedien
2003 Mahler: Sinfonie Nr. 2 »Auferstehungssinfonie« (Gvazava, Larsson, Orfeón Donostiarra, Lucerne FO; EuroArts) 2006 Schönberg: Pelleas und Melisande / Mahler: Sinfonie Nr. 4 (Juliane Banse, GM JO; Medici Arts) 2011 Bruckner: Sinfonie Nr. 5 [Ed. Nowak] (Lucerne FO; Accentus)
Das klingende Haus (Film von Daniele Abbado; Sony 1994) A Trail on the Water. Abbado – Nono – Pollini (Dokumentation von Bettina Ehrhardt; EuroArts 2001) Claudio Abbado – Die Stille hören (Dokumentation von Paul Smaczny; EuroArts 2003)
Schriften
Das Haus voll Musik, Illustrationen von Paolo Cardoni, übs. von Maja Pflug, Zürich 1986 Meine Welt der Musik. Orchester und Instrumente entdecken, Illustrationen von Paolo Cardoni, übs. von Claudia Theis-Passaro, München 2012
Literatur
Das Berliner Philharmonische Orchester mit Claudio Abbado, Beiträge von Helge Grünewald u. a., Fotografien von Cordula Groth, Berlin 1994 Frithjof Hager, Claudio Abbado. Die Anderen in der Stille hören, Frankfurt a. M. 2000 Lidia Bramani, Claudio Abbado. Musik über Berlin, übs. von Agnes Dünneisen und Beatrix Birken, Frankfurt a. M. 2001 Christian Försch, Claudio Abbado. Die Magie des Zusammenklangs, Berlin 2001 Ulrich Eckhardt (Hrsg.), Claudio Abbado. Dirigent, Berlin 2003
Webpräsenz
www.ne.jp/asahi/claudio/abbado/discography/discography_frame.html
JCA