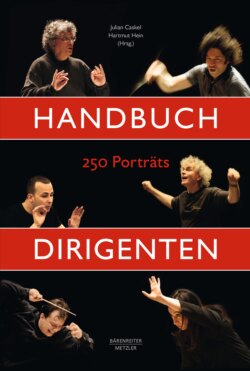Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 23
Ashkenazy, Vladimir
Оглавление1937 am 6. Juli im sowjetischen Gorki (eigentlich Nischni Nowgorod) geboren. Beide Eltern – der Vater jüdischer Herkunft – haben eine Klavierausbildung und arbeiten u. a. als Schauspieler und Musiker in einem reisenden Varieté-Theater. Die Familie gelangt drei Jahre später nach Moskau.
1945 beginnt an der Zentralmusikschule Moskau seine intensive Klavierausbildung bei Anaida Sumbatian.
1953–1960 ist er Schüler von Lew Oborin und vor allem von Boris Zemlianski am Moskauer Konservatorium. Während der Studienzeit gewinnt er nach einem Zweiten Preis beim Chopin-Wettbewerb in Warschau (1955) den Brüsseler Concours Reine Elisabeth (1956) und wird dann auch auf Tourneen in Deutschland (1957) und den USA (1958) präsentiert.
1961 heiratet er Thórunn Jóhannsdóttir, eine isländische Gaststudentin am Moskauer Konservatorium; seine beiden Söhne sind ebenfalls Musiker: Vovka (Vladimir) Pianist, Dimitri Klarinettist.
1962 bestätigt er seinen Ausnahmerang unter dem traditionell starken sowjetischen Pianistennachwuchs durch den Gewinn des zweiten Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs (gemeinsam mit dem Briten John Ogdon) und darf wiederum Nordamerika bereisen.
1963 verbringt er die ersten Monate demonstrativ in Großbritannien bei seinen Schwiegereltern, wird ausgebürgert, kehrt dennoch nach Moskau zurück, wird dort |70| vom KGB festgehalten und erhält von Chruschtschow schließlich die endgültige Ausreiseerlaubnis; er lebt mit seiner Familie zunächst in London und entwickelt, mit einem Exklusivvertrag des Labels Decca ausgestattet, zunächst seine internationale Pianistenlaufbahn.
1968 wird die Familie in Island ansässig,
1972 wird er isländischer Staatsbürger und sammelt im selben Jahr erste Erfahrungen als Dirigent dortiger Orchester; sein Hauptwohnsitz wird später jedoch die zentraler gelegene Schweiz.
1977 treibt er – ähnlich wie wenige Jahre zuvor Daniel Barenboim – seine internationale Dirigentenlauf bahn mit ersten Auftritten in England und einer sukzessive entstehenden Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte Mozarts voran. Die von Beginn an glückliche Zusammenarbeit mit dem Philharmonia Orchestra (PhO) setzt sich in Decca-Produktionen russischer Orchesterwerke und der Sinfonien von Jean Sibelius bis in die 1980er-Jahre hinein fort.
1987 übernimmt er seine erste Position als Chefdirigent beim Royal Philharmonic Orchestra. Außerdem ist er nun dem Cleveland Orchestra als Erster Gastdirigent verbunden, es entsteht dort ein weiterer Aufnahmezyklus mit Orchesterwerken von Richard Strauss (Ashkenazy übernimmt damit in Cleveland und bei Decca das spezifische Kernrepertoire von Lorin Maazel, der zur Konkurrenz – nach Wien und zur DGG – gewechselt ist).
1989 wird er Nachfolger Riccardo Chaillys beim Radio-Symphonie-Orchester Berlin. Er wird bei diesem Orchester für ein gutes Jahrzehnt inklusive Namenswechsel – seit 1993 heißt es Deutsches Symphonie-Orchester Berlin – bleiben. Im Jahr seines Dienstantritts kehrt er erstmals mit dem Royal Philharmonic Orchestra zu Konzerten nach Moskau zurück (1994 kündigt er den Posten in London, da das Orchester hinter seinem Rücken bereits um Daniele Gatti als Nachfolger wirbt).
1998–2003 übernimmt er die Leitung der Tschechischen Philharmonie und lässt die Ära in Berlin aufgrund der dort andauernden Finanzierungsdiskussionen auslaufen; mit Decca bleibt er zwar weiterhin als Pianist verbunden, nimmt aber nun als Dirigent für das finnische Label Ondine auch eher entlegenes und zeitgenössisches Repertoire in Prag und Helsinki auf.
2004–2007 folgt eine Verpflichtung in Japan als Chefdirigent des NHK-Sinfonieorchesters Tokio.
2009 tritt er im Januar die Leitung des Sydney Symphony Orchestra an; als herausragendes Projekt entsteht ein kompletter Zyklus der Sinfonien Gustav Mahlers in dessen Gedenkjahren 2010/11.
2014 wird David Robertson sein Nachfolger in Sydney; mit 76 Jahren gastiert Ashkenazy weiterhin weltweit.
Mit dem Gespür des mit den Händen erzählenden Pianisten und der genauen Umsetzung russisch-sowjetischer Aufführungstraditionen gestaltete Ashkenazy Ende der 1970er-Jahre seine ersten Dokumente als Dirigent mit den berühmten letzten drei Sinfonien Tschaikowskys so ganz anders als der inzwischen durch Karajan, Maazel und Muti auf rhythmische Konstanz und ausgewogene Mischung der Orchesterfarben eingeschworene Mainstream. Mit dem damals gerade von Riccardo Muti auf »westliche« Perfektion getrimmten Philharmonia Orchestra entwickelte er ein »slawisches« Neo- bzw. Retro-Espressivo als eigensinniges Kontrastprogramm. Jedes Thema hat sein eigenes Tempo: am extremsten im Kopfsatz der 4. Sinfonie, am stärksten mitreißend in der gesamten Fünften, wo der je nach Satzcharakter elegische bis final turbulente Auswurf immer neuer Themengestalten und rhythmischer Fakturen in quasi Rachmaninow’schen Spannungsbögen profiliert wird – durch stimmiges Verlangsamen und Beschleunigen, in stets artikulatorisch prägnanter, doch manchmal ungewohnter, implizit pianistisch gedachter Akzentuierung, in der Bildung melodischer Phrasen völlig überzeugend. Den Eindruck, dass hier ein geborener Dirigent für das russische und skandinavische Repertoire agiert, bestätigen über zwei Jahrzehnte hinweg in der Kritik schnell hochgelobte Zyklen – Rachmaninow, Skrjabin, Sibelius und Schostakowitsch sowie Strauss und Brahms in Cleveland, durch das prunkende Blech mit »russischem Akzent« gefärbt (durchaus ähnlich den Aufnahmen Jewgeni Mrawinskis im deutschen romantischen Repertoire, aber noch viel kultivierter im Sound des Digitalzeitalters).
Jedes Tempo wird zu einem eigenen Thema; Ashkenazys Verständnis der Wiener »Klassiker« scheint hingegen von der Maxime geprägt, das anfangs angeschlagene Tempo in der Regel als konstante Grundlage für beredte Variationen der Klangfarbe und Phrasierung zu nutzen. So entsteht der Eindruck einer unerhörten Mannigfaltigkeit in jener charakteristischen Einheit, die noch an die Affektenlehre wie an das Improvisationstalent barocker Vorläufer erinnert. In der Tempokonstanz gegenläufig zur damals bereits im Trend stehenden expressiven Re-Historisierung von Klassik und Frühromantik haben diese Zyklen (u. a. der Sinfonien und Klavierkonzerte Beethovens) weniger |71| Wertschätzung erfahren als womöglich angemessen: Herausstechend erscheint vielleicht ein in allem, was Odem und Saiten entspringt, stark und präzise durchphrasierter Berliner Mendelssohn-Zyklus, der tatsächlich beide Ansatzpunkte Ashkenazys – nämlich euphorisch expressive Kantabilität mit rhythmischer Prägnanz – vereint. Hier wie dann auch in seinen zahlreichen Zugriffen auf Musik des 20. Jahrhunderts zeigt sich eine ungezwungene Natürlichkeit der Klangregie, ein quasi selbstverständlich wirkendes Musizieren in treffenden Idiomen, wie man sie kaum von einem »Moderne-Spezialisten« erhalten würde – das bekommt etwa der Musik Einojuhani Rautavaaras ausgezeichnet. In Ashkenazys Mahler-Zyklus aus Sydney (2010/11) wird auch dank der exzellenten Aufnahmetechnik direkt und ungebrochen in schönem Ton wie in dramatischen Gesten agiert (auch das hat russische Tradition), wiederum ergeben sich eine Vielzahl individueller, überzeugender Effekte. Eine Dirigentenkarriere läuft hier aus, deren breite Hinterlassenschaft heutigen Hörern inzwischen eher in Budget-Paketen nachgeworfen wird – und diese Hörer dürften überrascht und dem bescheiden auftretenden Enthusiasten äußerst dankbar sein, denn interessantere, besser gemachte Interpretationen heutiger Stardirigenten (nicht zuletzt russischer) zu finden, dürfte oft schwierig werden.
Tonträger
1972–1987 Mozart: Klavierkonzerte Nr. 1–27 (PhO; Decca) 1977 Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 (PhO; Decca) 1980 Sibelius: Sinfonie Nr. 4 / Finlandia / Luonnotar (Elisabeth Söderström, PhO; Decca) 1989 Britten: Serenade / Knussen: Sinfonie Nr. 3 / Walton: Sinfonie Nr. 2 (Martyn Hill, Jeffrey Bryant, Royal PO; RPO Records) 1992 Brahms: Sinfonie Nr. 4 / Händel-Variationen [Orchestration: Rubbra] (Cleveland Orchestra; Decca) 1993–1996 Mendelssohn: Sinfonien Nr. 1–5 (DSO Berlin; Decca) 1995 Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 7 »Leningrader« (St. Petersburg PO; Decca) 1999 Rautavaara: Klavierkonzert Nr. 3 »Gift of Dreams« / Autumn Gardens (Helsinki PO; Ondine) 2005/07 Martinů: Klavierkonzerte Nr. 2 & 4 »Incantation« / Ouvertüre H. 345 / Les Fresques de Piero della Francesca (Robert Kolinsky, SO Basel; Ondine) 2011 Mahler: Sinfonie Nr. 10 [Aufführungsversion von Rudolf Barshai] (Sydney SO; SSO Live)
Bearbeitungen
Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung (PhO; Decca 1982)
Literatur
Jasper Parrott, Vladimir Ashkenazy. Jenseits von Grenzen, übs. von Elsbeth Drugowitsch, Zürich 1987
HAH