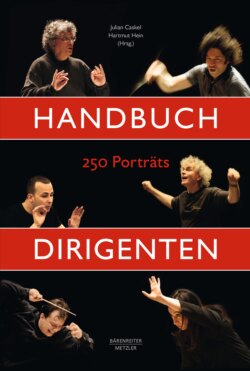Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 14
|58| Abendroth, Hermann
Оглавление1883 am 19. Januar in Frankfurt am Main geboren.
1901–1905 studiert er im Anschluss an eine Buchhändlerlehre Komposition bei Ludwig Thuille und Dirigieren bei Felix Mottl an der Münchner Königlichen Akademie der Tonkunst.
1905–1911 Tätigkeit als Städtischer Kapellmeister in Lübeck, daneben ist er Assistent Felix Mottls bei Wagner-Aufführungen in München und Bayreuth.
1911 geht Abendroth als Städtischer Musikdirektor nach Essen.
1915–1934 ist Abendroth – als Nachfolger von Fritz Steinbach – Kölner Gürzenich-Kapellmeister. Er wird 1918 zum Generalmusikdirektor ernannt, außerdem leitet er gemeinsam mit Walter Braunfels das Konservatorium, das 1925 von Oberbürgermeister Konrad Adenauer zur Staatlichen Musikhochschule aufgewertet wird.
1934–1945 wird er – nachdem ihn die Kölner Nationalsozialisten mit massiver Opposition bedrängt hatten – Gewandhauskapellmeister und Dirigierprofessor in Leipzig. Diese Position macht ihn aufgrund der von den Nationalsozialisten unterdrückten Mendelssohn-Tradition angreifbar.
1937 tritt er der NSDAP bei. Zudem ist er Leiter der Fachschaft Musikerziehung in der Reichsmusikkammer.
1945 wird Abendroth in Leipzig wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft entlassen; er zieht nach Weimar und wird dort Leiter der Staatskapelle und Professor an der Musikhochschule.
1949 erhält Abendroth den Nationalpreis der DDR und übernimmt – neben seinem Weimarer Dirigentenamt – das Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig.
1953 wird er Weimarer Ehrenbürger; als drittes Orchester leitet er das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB).
1956 stirbt er am 29. Mai in Jena.
Das künstlerische Schicksal von Hermann Abendroth ist ohne den Seitenblick auf die deutsche Geschichte nicht denkbar, sein Andenken leidet an deren Konsequenzen: 1933 war Abendroth zunächst ein Opfer nationalsozialistischer Agitation; dass er 1937 der NSDAP beigetreten war und eine herausgehobene Position in der Reichsmusikkammer eingenommen hatte, wurde ihm wiederum 1945 zum Verhängnis, als ihm deswegen nach elf Jahren am Gewandhaus in Leipzig gekündigt wurde. Der immerhin 62-jährige Dirigent war froh um die Chance eines nochmaligen Neubeginns in Weimar, auch wenn er für die dortigen Verhältnisse eine Nummer zu groß war. Weimar hat es ihm treu gedankt, doch Abendroths Anpassung an die Verhältnisse der DDR veranlasste nun wiederum Konrad Adenauer, der ehemals mit ihm befreundet war, gegen Gastdirigate Abendroths im Westen strikt vorzugehen.
Abendroths diskografische Hinterlassenschaft, vor allem für den Rundfunk aufgenommen, engt sein musikalisches Profil zwar auf die Schlachtrösser des sinfonischen Betriebs ein, zeigt ihn aber gleichwohl als Dirigenten einer älteren Tradition in einer historischen Umbruchszeit: Abendroth hatte mit Felix Mottl und Fritz Steinbach noch die Hausdirigenten von Wagner und Brahms erlebt, die ihm die Traditionen des 19. Jahrhunderts in lebendiger Handreichung vermitteln konnten. Anschaulich wird dies in der flexiblen, mit den feinsten dynamischen Prozessen korrespondierenden Tempogestaltung seiner Brahms Interpretationen, beispielsweise im Andante sostenuto der 1. Sinfonie: Abendroth rückt immer wieder motivische Einzelheiten und Themenübergänge verlangsamt aus dem Grundtempo heraus und legt die großen Bläserpassagen beinahe rhapsodisch an, indem er den Solisten umfassende agogische Freiheiten lässt.
Tonträger
1927 Brahms: Sinfonie Nr. 4 (London SO; Biddulph) 1941 Brahms: Sinfonie Nr. 1 (BPh; Iron Needle) 1955 Schumann: Sinfonie Nr. 1 »Frühlingssinfonie« (RSB; Tahra)
Literatur
Jörg Clemen, Hermann Abendroth und das Gewandhausorchester, in: Thomas Schinköth (Hrsg.), Musikstadt Leipzig im NS-Staat. Beiträge zu einem verdrängten Thema, Altenburg 1997, S. 250–260 Irina Lucke-Kaminiarz, Hermann Abendroth – Ein Musiker im Wechselspiel der Zeitgeschichte, Weimar 2007 Markus Gärtner, »Kein Wort von Erfüllung meiner Bedingungen!« Der Briefwechsel zwischen Hermann Abendroth und Hans Pfitzner, in: Die Tonkunst 2 (2008), S. 229–240
MIS