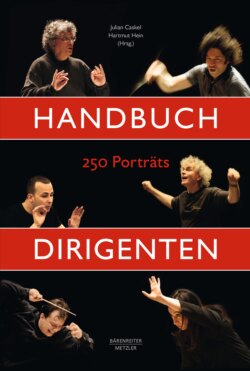Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 15
Abravanel, Maurice
Оглавление1903 am 6. Januar geboren in Thessaloniki (Griechenland) als Sohn spanischer Eltern mit sephardischen Wurzeln, wächst er in der Schweiz in Lausanne auf, wo Ernest Ansermet ein früher Mentor ist.
1922 zieht er nach Berlin und ist kurzzeitig Schüler von Kurt Weill.
|59| 1931 debütiert er nach Engagements bei Popularmusikorchestern und in der deutschen Provinz (in Neustrelitz, Zwickau, Altenburg und Kassel) an der Berliner Staatsoper mit Verdis La forza del destino.
1933 Exil in Paris, wo er als Assistent von Bruno Walter und für die Ballets russes von George Balanchine arbeitet, und später in Australien, wo er auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nochmals dirigiert.
1936 tritt er als bis dato jüngster Dirigent an der Metropolitan Opera in New York auf.
1938 leitet Knickerbocker Holiday die erneute Zusammenarbeit mit Kurt Weill am Broadway ein.
1947–1979 ist er Chefdirigent des Utah Symphony Orchestra, das er als Teilzeitorchester mit einem Einjahresvertrag übernommen hat.
1950 erhält er für die Broadway-Produktion von Marc Blitzsteins Regina einen Tony Award.
1954–1980 ist er Musikdirektor der Music Academy of the West in Santa Barbara.
1966 führt die erste internationale Tournee das Utah Symphony Orchestra nach Deutschland und auch nach Griechenland.
1981 beginnt er, Dirigierkurse in Tanglewood abzuhalten.
1993 stirbt er in Salt Lake City am 22. September.
Maurice (de) Abravanels langer Weg nach Westen bleibt klanglich nur an den amerikanischen Wegstationen dokumentiert. So sind aus seiner Zeit in New York Rundfunkmitschnitte von Broadway-Produktionen Kurt Weills und von Aufführungen der Metropolitan Opera erhalten. Untrennbar verbunden ist sein Name jedoch mit dem Utah Symphony Orchestra, dessen Heimat in Salt Lake City heute die Abravanel Hall ist. Seine Klangästhetik jedoch behält eine frühe europäische Prägung durch die Neue Sachlichkeit und den Songstil Kurt Weills. Solistische Farbwerte erhalten den Vorrang vor der Homogenität des Gesamtklangs, sodass die Partituren gleichsam von oben nach unten statt vom Streicherfundament aus gelesen werden. Wie bei einem guten Cartoonisten bekommen so ganz verschiedene Protagonisten ein immer gleiches spezifisches Merkmal zugewiesen: Was bei Loriot die Knollennase ist, sind in Abravanels Aufnahmen die Haifischzähne der Dreigroschenoper. Der stilisierte Sound eines Spelunkenorchesters passt nicht nur zum Scherzothema von Tschaikowskys Pathétique, der beinahe spöttische Duktus kann an überraschenden Orten zu subtilen Ergebnissen führen: So spielt Abravanel Brahms’ mittlere Sinfonien, als wären es die frühen Schuberts. Besonders bewährt sich dieser Ansatz als »Bombast-Bremse«, in Oratorien des 20. Jahrhunderts wie Honeggers Judith und Le Roi David ebenso wie in Schaustücken der Romantik (großartig lakonisch z. B. die Marche slave Tschaikowskys und auch der Marschsatz in dessen 2. Sinfonie). Unzweifelhaft ist dabei die Herkunft dieser Ästhetik aus der Moderne: In Prokofjews 3. Sinfonie lässt Abravanel die bruitistischen und melodischen Elemente der Partitur sich gegenseitig verstärken, und das wohltuend wenig zurückhaltende Schlagwerk verbindet Leroy Andersons The Typewriter mit Edgard Varèses Amériques.
Vor diesem Hintergrund überrascht Abravanels Neigung zu manchmal durchaus willkürlichen Tempoentscheidungen: Das gemächliche Allegro im Kopfsatz und das Accelerando am Ende des Scherzos der Pathétique sind hierfür prototypisch. Gegen veraltete klangtechnische Standards gelingen zugleich immer wieder originelle Phrasierungsdetails (vor allem durch abgeschliffene oder verlängerte und so unberechenbar gehaltene Endnoten einzelner Motive). Abravanels Mahler-Zyklus ist in Deutschland der ewige Geheimtipp geblieben, wobei der knabenhafte Sopran von Netania Davrath in der Vierten und der gut getroffene Grundklang der Siebten besonders eindrücklich bleiben. Seine umfangreiche Diskografie mit Zyklen der Sinfonien auch von Brahms, Tschaikowsky und Sibelius sowie Referenzaufnahmen einiger selten gehörter Werke des 20. Jahrhunderts könnte heute als Vorläufer der Independent-Kultur des Plattenmarkts neu entdeckt werden.
Tonträger
1967 Bloch: Schelomo / Sinfonie »Israel« (Zara Nelsova, Utah SO; Vanguard) 1968 Mahler: Sinfonie Nr. 4 (Netania Davrath, Utah SO; Vanguard) 1972 Bernstein: Candide-Ouvertüre / Gould: American Salute / Siegmeister: Western Suite (Utah SO; VOX) 1972/73 Tschaikowsky: Sinfonien Nr. 1–6 / Marche slave etc. (Utah SO; VOX)
Literatur
Lowell Durham, Abravanel!, Salt Lake City 1989
JCA