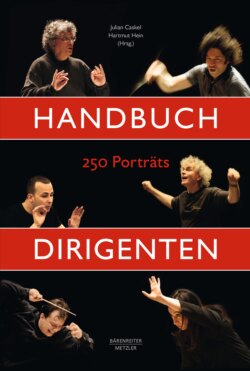Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 20
|64| Ančerl, Karel
Оглавление1908 am 11. April in Tučapy geboren, wo er früh Violinunterricht erhält.
1930 Als Abschlusskonzert seiner Ausbildung am Prager Konservatorium (u. a. Meisterklassen bei Václav Talich) dirigiert er die Tschechische Philharmonie (Czech PO) mit seiner eigenen neoklassischen Sinfonietta. In den Jahren nach 1930 kommt es u. a. zu Engagements als Dirigent von Salonjazz am Befreiten Theater von Jaroslav Ježek und bei Festivals zeitgenössischer Musik (vor allem im Umfeld von Hermann Scherchen, z. B. bei der Uraufführung von Alois Hábas »Viertelton-Oper« Die Mutter in München im Jahr 1931).
1942 Nach der Okkupation durch das nationalsozialistische Deutschland erlebt Ančerl die Perversion, dass es ihm in Freiheit unmöglich ist, als Dirigent zu arbeiten, während er nach seiner Gefangennahme im Konzentrationslager Theresienstadt ein Streichorchester zusammenstellen kann (das in dem unter dem Titel Der Führer schenkt den Juden eine Stadt bekannt gewordenen Propagandafilm dokumentiert ist). Seine Familie wird in Auschwitz ermordet, während Ančerl selbst in verschiedenen Arbeitslagern den Holocaust überlebt. Nach Kriegsende heiratet er erneut, er leidet bis an sein Lebensende unter den Spätfolgen der Gefangenschaft.
1945 beginnt Ančerls einzige Phase als Operndirigent am Prager Theater des 5. Mai (dem vormaligen deutschen Opernhaus).
1947–1950 leitet er das Prager Radio-Sinfonieorchester und unterrichtet ab 1948 für kurze Zeit Dirigieren an der Musikakademie.
1950 folgt – auf Betreiben der kommunistischen Staatsführung – die Berufung als Nachfolger von Karel Šejna und des emigrierten Rafael Kubelík zum Chefdirigenten der Tschechischen Philharmonie.
1959 Eine Welttournee dokumentiert einen Höhepunkt innerhalb der 18 Jahre Ančerls als Chefdirigent.
1968 Ančerl wird Chefdirigent des Toronto Symphony Orchestra, ein Jahr später dirigiert er als Reaktion auf die Niederschlagung des Prager Frühlings zum letzten Mal die Tschechische Philharmonie.
1973 stirbt er am 3. Juli in Toronto.
Welcher Dirigent ist der Antipode Herbert von Karajans? Das Feuilleton hat für diese Rolle so unterschiedliche Namen wie Bernstein, Solti oder Harnoncourt vorgeschlagen. Kaum einer aber stellt so eindeutig wie Karel Ančerl biografisch und auch ästhetisch ein Gegenmodell zu Karajan dar (obgleich ihre Geburtsdaten nur sechs Tage auseinanderliegen). Ančerls biografischer Weg führt aus der Provinz in die Metropole – wobei vom Beruf des Vaters als Spirituosenhändler bis zum späten Gang nach Amerika Parallelen zum »dreifach heimatlosen« Gustav Mahler bestehen. Der Beginn seiner Karriere aber erfolgt nicht im Provinztheater, sondern in der internationalen und urbanen Szene der zeitgenössischen Musik, und dies erzeugt auch ein anderes Stammrepertoire: Ančerls Markenkern sind nicht zuletzt die »Klassiker der Moderne«.
Ančerl besitzt im Gegensatz zum »kapitalistischen« Karajan eine typisch »sozialistische« Diskografie: Wo Karajan Plattenlabels und Orchester gegeneinander ausspielen konnte, ist Ančerls Diskografie das Produkt eines Monopolproduzenten, sodass dort Lücken bestehen, wo andere tschechische Dirigenten tschechisches Kernrepertoire schon eingespielt hatten. Trotz einiger früher Dvořák- und Tschaikowsky-Aufnahmen für das Label Philips Montana mit den Wiener Symphonikern und vereinzelten Kooperationen mit der Deutschen Grammophon (wie bei Dvořáks Requiem) scheint seine heutige Reputation nahezu synonym mit den Aufnahmen für das staatliche Label Supraphon. Für Supraphon spielten Gesamteinspielungen jedoch zunächst nur eine geringe Rolle, weshalb Ančerl keinen einzigen Komplettzyklus vorgelegt hat. Seine Diskografie ist so nach heutigen Maßstäben eher klein, immer auch bedauerlich unvollständig, aber dafür umso bunter.
Gut dokumentiert ist sein vor dem Zweiten Weltkrieg mit tschechischen Erstaufführungen der Wiener Schule begonnenes und lebenslang beibehaltenes Engagement für zeitgenössische Musik. So eröffnen die beeindruckenden Oratorien von Ladislav Vycpálek Einblicke in eine vergessene Traditionslinie spätromantischer Musik, und bei seinen häufigen Gastdirigaten in Westeuropa nimmt Ančerl neben Janáčeks Sinfonietta und Taras Bulba immer wieder Sinfonien des Exilanten Bohuslav Martinů in seine Programme auf.
Ančerls Aufnahmen sind auch ästhetisch ein Gegenentwurf zu Karajan: Wo dieser möglichst viele Detailakzente zugunsten seines Legato-Ideals unterschlägt, zielt Ančerls Staccato-Artikulation darauf, möglichst viele Einzelakzente hörbar zu machen. Beispielhaft hierfür ist der zweite Satz von Mahlers 9. Sinfonie: Während |65| der »horizontale« Ablauf Tempoextreme vermeidet, dürfen die »vertikal« aufgefächerten orchestralen Einzelfarben rücksichtslos auseinandertreten.
In den Slawischen Tänzen Dvořáks tritt dieses Spaltklang-Prinzip besonders deutlich hervor. Die Grundregel, dass ein Einzelton bei einem Staccato zu verkürzen, aber bei einem Legato voll auszuspielen sei, wird in Ančerls Einspielung mit den Wiener Symphonikern außer Kraft gesetzt: Stattdessen wird immer wieder das Staccato einzelner Noten zum Auslöser minimaler Verzögerungen, nach denen mehrere auftaktige Legato-Noten leicht beschleunigt werden (dies ist besonders gut in op. 46 Nr. 5 zu hören). Dieses »beschleunigende Legato« findet sich auch in Ančerls inoffiziellen Einspielungen der Slawischen Tänze, die das Label Tahra dokumentiert hat, während es bei anderen tschechischen Dirigenten wie Václav Neumann und Karel Šejna nur in abgeschwächter Form zu hören ist und bei einer ebenso in den 1950er-Jahren entstandenen Einspielung wie derjenigen Artur Rodzińskis mit dem Royal Philharmonic Orchestra fast gar nicht; hier wird derselbe Eindruck folkloristischen Schwungholens umgekehrt durch ein extrem verkürztes Staccato erzeugt (so in op. 46 Nr. 7), das gegen die bewahrte, weil bewährte Legato-Artikulation absticht.
Ančerl verbindet so ein Klangbild, in dem das Orchester durch die vom Schönklang Ideal abweichenden Instrumentalfarben noch nicht ganz in der Moderne angekommen zu sein scheint, mit einer strikt modernistischen Aufführungshaltung. So sehr sich der Orchesterklang dabei als böhmische Musikantenkapelle inszenieren kann, so sicher ist dies keine ins Stereo-Zeitalter gerettete »Authentizität«: Ančerl übernimmt zwar Details wie die Flatterzungen-Artikulation im Trioteil von Dvořáks 9. Sinfonie von Václav Talich, betont aber im böhmischen Repertoire vor allem die strukturellen Abläufe. Viel eher erscheint sein Orchesterklang als Parallelerscheinung zugleich folkloristischer und maschinenhafter Kompositionsprinzipien des 20. Jahrhunderts. In diesem Repertoire setzt Ančerl darauf, die neusachliche Exaktheit durch Überspitzungen wieder expressiv zu machen. Ostinate Figuren lässt er oftmals so ausführen, dass mehrere notierte Töne in einen geradezu ekstatischen und glissandoartigen Einzelakzent überführt werden. Beispiele dafür finden sich im dritten Satz von Janáčeks Sinfonietta oder im bruitistisch aufgefassten Intermezzo aus Bartóks Konzert für Orchester. Andererseits lässt Ančerl gemäß der osteuropäischen Orchestertradition ein relativ starkes Vibrato-Spiel zu (wie in den Soli der Trompete und Flöte in Strawinskys Petruschka).
»Tybalts Tod« aus Prokofjews Romeo und Julia – sicherlich eine der besten Aufnahmen Ančerls – zeigt dieses Vorgehen in besonders eindrücklicher Weise. Hier tritt seine Fähigkeit hervor, einen motorischen Ablauf gerade aus der relativen Zurückdrängung der rein perkussiven Elemente entstehen zu lassen. Das Solo der kleinen Trommel, das in einer modernen Einspielung (wie etwa derjenigen Paavo Järvis) als zusätzlicher Verstärkereffekt eingesetzt wird, ist für Ančerl unnötig, da bei ihm das Motorische keine zur Melodik hinzutretende Begleitschicht ist, sondern eine Begleiterscheinung der Melodik selbst.
Ančerls Schlaggestus, bei dem runde, den lauten Klang von sich weg weisende Bewegungen mit rhythmischen Nachzeichnungen auch durch die linke Hand verbunden werden, hinterlässt einen eher unverbindlichen Eindruck. Überspitzt gesagt: Man würde in Ančerl auf dem Konzertpodium nicht unbedingt den Dirigenten seiner eigenen Aufnahmen vermuten. Das Missverhältnis zwischen Aufnahmen, die bleiben, und Konzerterinnerungen, die vergehen, scheint zu seinen Gunsten auszuschlagen.
Einige Aufnahmen Ančerls zerfallen in Teile unterschiedlicher Qualität. Die Nachzeichnung langer Melodiebögen gehört nicht unbedingt zu seinen Stärken, sodass der Kopfsatz von Schostakowitschs 10. Sinfonie nicht ganz mit derselben Intensität erklingt wie das berühmte »Stalin-Scherzo«, das nur in Ančerls |66| Aufnahme in einem solch raschen Tempo noch eine sinnvoll gegliederte Struktur bewahrt. In den beiden letzten Sätzen der Sinfonie jedoch entsteht der große Bogen, ohne dass Ančerl als Dirigent etwas machen muss: Die Farbwechsel des Orchesterklangs erzeugen hier die Form quasi von selbst.
Karajan und Ančerl könnte also miteinander verbinden, dass die Unverwechselbarkeit ihrer Interpretationen in ihre – allerdings gänzlich konträren – Vorstellungen vom Orchesterklang vorgelagert scheint. Individuell ist bei Ančerl das Kollektiv. Wenn ein Werk diesen Mehrwert durch den Individualklang jedoch nicht nötig hat, tritt hervor, wie wenig individuell Ančerls allerdings stets präzise einstudierte Interpretationen manchmal sein können (und wollen). Dies gilt gerade für seine nicht zahlreichen Einspielungen aus dem sinfonischen Kernrepertoire. Ančerl selbst hat immer Mozart als seinen Lieblingskomponisten genannt. Seine heutige Wertschätzung dagegen dokumentiert auch eine Verschiebung in der Frage, welches Repertoire als Maßstab dafür gilt, ob ein Dirigent selbst für maßgeblich gehalten wird. Gäbe es »Klassiker der Moderne« auch unter Dirigenten, so wäre Ančerl einer von ihnen.
Tonträger
1955 Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 10 (Czech PO; DGG) 1957 Vycpálek: Kantate über die letzten Dinge des Menschen (Czech PO; Supraphon) 1958 Dvořák: Slawische Tänze op. 46 (Wiener Symphoniker; Philips) 1959 Dvořák: Requiem (Stader, Wagner, Haef liger, Borg, Czech PO; Supraphon / DGG) 1959 Prokofjew: Romeo und Julia [Auszüge aus den Suiten] (Czech PO; Supraphon) 1961 Janáček: Sinfonietta / Glagolitische Messe (Domanínská, Soukupová, Blachut, Haken, Prague Philharmonic Choir, Czech PO; Supraphon) 1961 Martinů: Klavierkonzert Nr. 3 (Josef Páleníček, Czech PO; Supraphon) 1962/63 Strawinsky: Petruschka / Le Sacre du printemps (Czech PO; Supraphon) 1966 Mahler: Sinfonie Nr. 9 (Czech PO; Supraphon) 1971 Martinů: Sinfonie Nr. 5 (Toronto SO; IMG Artists)
Bildmedien
1968 Smetana: Má vlast [Mein Vaterland] etc. [+ Dokumentation: Who Is Karel Ančerl?] (Czech PO; Supraphon)
Literatur
Tully Potter, Time’s Arrow, in: Gramophone 8/2003, S. 30 f. Jindřich Bálek, Karel Ančerl: The Legendary Conductor, in: Czech Music Quarterly 4 (2007), S. 19–25
Webpräsenz
www.karel-ancerl.com [Diskografie und Konzertverzeichnis]
JCA