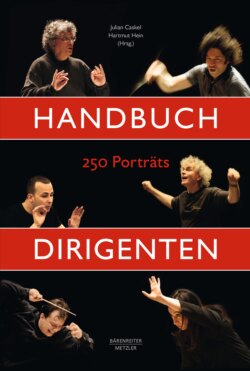Читать книгу Handbuch Dirigenten - Группа авторов - Страница 21
Ansermet, Ernest
Оглавление1883 am 11. November in Vevey geboren. In Lausanne und Paris studiert er Mathematik und Musik. Nach seinem Studienabschluss tritt er zunächst eine Stelle als Gymnasiallehrer für Mathematik an.
1911 debütiert er am 15. März als Dirigent in Lausanne mit dem Orchestre Symphonique.
1912 entscheidet er sich endgültig für eine Laufbahn als Dirigent und übernimmt die Leitung der Kursaal-Konzerte in Montreux (bis 1914). Er schließt eine enge Freundschaft mit Igor Strawinsky.
1915 beginnt Ansermet eine feste Zusammenarbeit mit Sergej Diaghilews Ballets russes, mit denen er 1916 eine USA-Tournee unternimmt und bis 1923 zahlreiche Uraufführungen realisiert.
1918 erfolgt die Gründung des Orchestre de la Suisse Romande (OSR), das Ansermet bis 1967 leitet.
1918 leitet er die Uraufführung von Strawinskys Histoire du soldat. In den 1920er-Jahren teilt er seine Arbeitszeit zwischen Europa und Sommeraufenthalten in Buenos Aires, später auch Mexiko auf.
1928 unterschreibt er einen Exklusivvertrag mit der englischen Decca.
1938 unterstützt er die Gründung des Lucerne Festival.
1945 verhilft er Wilhelm Furtwängler zur Einreise in die Schweiz.
1961 publiziert er sein musiktheoretisches Lebenswerk Les Fondements de la musique dans la conscience humaine.
1969 stirbt er am 20. Februar in Genf.
Ernest Ansermet gehörte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Speerspitze der ästhetischen Moderne: Als Dirigent von Sergej Diaghilews Ballets russes arbeitete er mit Künstlern wie Massine, Cocteau oder Picasso zusammen und machte die Welt erstmals mit Werken wie Erik Saties Parade, Manuel de Fallas El sombrero de tres picos [Der Dreispitz] oder Strawinskys Pulcinella bekannt; auch die deutsche Erstaufführung des Sacre in Berlin 1922 geht auf sein Konto. Überhaupt hat kaum ein Dirigent seiner Zeit derart viel zeitgenössische Musik uraufgeführt: Man denke nur an Strawinskys |67| Histoire du soldat oder die Psalmensinfonie (trotz der Kommission des Werks durch Koussevitzky).
Für das schweizerische Musikleben war Ansermets fortdauerndes Engagement von kaum zu überschätzender Bedeutung. Mit der Zusammenlegung einzelner Orchestervereinigungen aus der Region um den Genfer See zum Orchestre de la Suisse Romande schuf er einen Klangkörper, der sich im Laufe der Jahrzehnte weltweites Renommee erarbeitete. Schweizer Zeitgenossen wie Frank Martin, Ernest Bloch oder Arthur Honegger verdanken ihm hochkarätige (Ur-)Aufführungen, und das Lucerne Festival brachte auf politisch neutralem Boden berühmte Gegner des Faschismus wie Arturo Toscanini zurück nach Mitteleuropa (wenngleich die spätere Verklärung des Festivals als »antifaschistisches Bollwerk« die Tatsachen verzerrt).
Ansermets Schlagtechnik folgt klar den Idealen der sogenannten Neuen Sachlichkeit. Hans Heinz Stuckenschmidt beschreibt Ansermets Dirigat als »präzis, gemessen, sparsam in der Geste« und lobt seine »auf klare Rhythmik und transparenten Klang bedachte Stabführung« (FAZ 11. 11. 1963). In seinen Ausführungen zur »Geste des Dirigenten« begrenzt Ansermet die Aufgaben der Schlagtechnik auf die Vermittlung rhythmischer Impulse, deren klangliche Ausgestaltung dagegen letztlich im Verantwortungsbereich der Musiker bleibe. Die optimale Gestik sei daher »einheitlich und einfach – alles andere ist Theater«. Den schauspielerischen Momenten seiner Profession steht Ansermet ablehnend gegenüber: Die »Mode« des Dirigierens ohne Pult und Partitur verdächtigt er sogar, einem trügerischen Spiel Vorschub zu leisten, das den Anschein erweckt, als ob der Dirigent »die Musik aus sich selbst zöge und sie durch die Magie seiner Gesten aus dem Orchester aufsteigen ließe« (Ansermet 1985, S. 108 f.).
Voraushörbare Linienführungen, rhythmische Genauigkeit und eine ausgewogene Balance des Orchesterklangs sind zentrale Maximen von Ansermets Ästhetik, die ihre Wurzeln nicht zuletzt im Ballett hat: Die Akzente der Taktmetrik bleiben stets genau hörbar, und die Melodiephrasen werden im Detail sorgfältig abgerundet; auftrumpfendes Pathos, brutale Rupturen oder weit ausladende Rubati sind seinen Interpretationen dagegen fremd. Seine Einspielung von Beethovens Sinfonien beispielsweise steht klar unter diesen Vorzeichen: Der schlanke, agile Streicherklang ermöglicht Ansermets Ensemble gerade in den schnellen Finalsätzen (z. B. der Vierten) ein außerordentlich präzise abgestimmtes Zusammenspiel. Im Finale der Siebten bindet er die in vielen Aufnahmen »unbeherrscht« wirkenden eruptiv dynamischen Höhepunkte durch eine betont kurze, trockene Artikulation (besonders der Blechbläser) an einen ausgewogenen Orchesterklang zurück. Einkomponierte »Fehler« wie der doppelte Repriseneinsatz im Kopfsatz der Achten werden unter diesen Prämissen dagegen eher eingeebnet. Überhaupt denkt Ansermet die musikalische Form weniger vom einzelnen Ereignis, sondern vielmehr von der nuancierten Verdichtung her. Die Spannungsbögen im Kopfsatz von Borodins unvollendeter 3. Sinfonie konzipiert er durch genau bemessene Abstufungen im Tempo, die als abgestuftes Beschleunigen und Verlangsamen bis in einzelne Sequenzketten hineinspielen und so kontrastierende Abschnitte verbinden.
Im französischen Repertoire besticht Ansermet durch vornehme Unaufdringlichkeit. In Hector Berlioz’ Les Nuits d’été gibt sein Orchester die Phrasierung nur in Ansätzen vor und beschränkt die klanglichen Kontraste auf ein Minimum, sodass sich der lyrische Sopran Régine Crespins umso wirkungsvoller absetzen kann. Die Musik Debussys erhält bei Ansermet durch sparsames Rubato und fließende Tempoübergänge jederzeit klare Konturen. Selbst eine scheinbar erdenferne und melancholisch-freie Passage wie die einleitende Oboenmelodie der »Gigues« aus den Images folgt bei ihm bereits exakt dem Tempo des folgenden tänzerischen Abschnitts.
In der Strawinsky-Interpretation, zu deren Geschichte er in vielen Fällen wortwörtlich den |68| Auftakt gegeben hat, orientiert sich Ansermet stilsicher an den ästhetischen Leitlinien der Partitur: Der Orchesterklang spaltet sich in mehrere Schichten aus klar unterscheidbaren Klangfarben und Bewegungsmustern auf. Wie ernst es ihm damit ist, Strawinskys Dramaturgie aus der Summierung heterogener Klangschichten zu erzeugen, zeigt seine Aufnahme von Le Sacre du printemps, die in ihrem gemessenen Tempo und dem eher sparsamen Umgang mit dynamischen Extremen relativ lange Latenzzeiten in Kauf nimmt, um die ekstatischen Querstände der Orchesterakzente gegen Ende des ersten Teils umso wirkungsvoller vorzubereiten.
Ansermets mehrere hundert Seiten starker Theorieentwurf über Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewußtsein ist durch seine esoterische Verquickung von Klangphysik, Musikästhetik und Geschichtsphilosophie nur schwer zugänglich. Während er in seiner Parallelisierung zwischen Gesetzen der Akustik und »Gesetzen« des menschlichen Bewusstseins später von den Lehren Sergiu Celibidaches beerbt wurde (der sich ebenso wie Ansermet an die Phänomenologie Edmund Husserls anlehnt), stehen seine Angriffe auf die Zwölftontechnik argumentativ auf tönernen Füßen. In der Interpretation von Orchestermusik des 20. Jahrhunderts werden Ansermets Einspielungen ein wichtiger Bezugspunkt bleiben.
Tonträger
1946/47 Strawinsky: Der Feuervogel [1919] / Psalmensinfonie (London PO & Choir; Dutton) 1951 Ravel: Ma Mère l’oye (OSR; Naxos Historical u. a.) 1954 Borodin: Sinfonie Nr. 3 (OSR; Decca) 1957 Strawinsky: Le Sacre du printemps / Petruschka (OSR; Decca) 1957/61 Debussy: Printemps / Nocturnes / Images (OSR; Decca) 1958/60 Beethoven: Sinfonien Nr. 7 & 4 (OSR; Decca) 1961 De Falla: El sombrero de tres picos [Der Dreispitz] (OSR; Decca) 1961/68 Honegger: Sinfonien Nr. 2–4 (OSR; Universal Australia) 1963 Berlioz: Les Nuits d’été (Régine Crespin, OSR; Decca)
Schriften
Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewußtsein, München 1965 Die Geste des Orchesterdirigenten, übs. von Hedwig Kehrli, in: Der Dirigent, Zürich 1965, S. 18–24 Écrits sur la musique, hrsg. von Jean-Claude Piguet, Neuchâtel 1971 Gespräche über Musik [mit Jean-Claude Piguet], München 21985
Literatur
Bernard Gavoty, Ernest Ansermet, Fotografien von Jean Mohr, Genf 1961 Carl Dahlhaus, Ansermets Polemik gegen Schönberg, in: NZfM 127/5 (1966), S. 179–183 Jean-Louis Matthey (Hrsg.), Ernest Ansermet (1883–1969), Lausanne 1983 Jean-Jacques Langendorf, Ernest Ansermet oder eine Leidenschaft für das Authentische, übs. von Cornelia Langendorf, Genf 1997 Philippe Dinkel, Ansermet und die Geburt des Orchestre de la Suisse Romande. Die Entstehung eines Repertoires und einer Philosophie der Musik, in: Ulrich Mosch (Hrsg.), »Entre Denges et Denezy …«. Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900–2000, Mainz 2000, S. 63–75
FKR