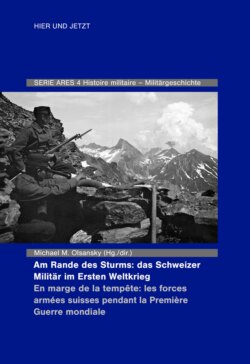Читать книгу Am Rande des Sturms: Das Schweizer Militär im Ersten Weltkrieg / En marche de la tempête : les forces armées suisse pendant la Première Guerre mondiale - Группа авторов - Страница 21
IV.
ОглавлениеEin Ausblick auf das 20. Jahrhundert offenbart die anhaltenden Schwierigkeiten von Armee und Behörden gleichermassen, Form und Funktion der militärischen Landesverteidigung auf der Höhe der jeweiligen Gegenwartsprobleme zu reflektieren und insbesondere aussen- sowie volkswirtschaftlichen Bedingungen, Restriktionen und Potenzialen Rechnung zu tragen. Im Ersten Weltkrieg hatte sich der enge Nexus zwischen wirtschaftlicher und politischer Abhängigkeit das erste Mal mit voller Wucht bemerkbar gemacht. Die damals ersichtlichen Asymmetrien in der Landesverteidigungskonzeption überdauerten das Kriegsende. Im Zweiten Weltkrieg trat dann «der Antagonismus zwischen ‹Landesverteidigung› und ‹Kriegsführung›» klar zutage, womit das Bewusstsein für die Tatsache geschärft wurde, dass «das Überleben [militärisch] nur gesichert werden [konnte], wenn dies auch wirtschaftlich der Fall war».44 Doch auch damals setzte sich die Einsicht, dass eine glaubhafte Dissuasionsstrategie […] «ausschliesslich im Rahmen einer umfassenden sicherheitspolitischen Konzeption denkbar» war, nicht durch.45 Es gab zwar Ansätze zu einer «strategischen Synthese», welche die konfligierenden Ressourcennutzungen und Zielkonflikte auf ein Sicherheitsoptimum hin auszutarieren trachtete.46 Eine weiterführende, auf sicherheitspolitischer und ebenso ökonomischer Expertise basierende Diskussion über eine mehrdimensionale Landesverteidigung wurde indessen nach 1945 durch die historische Mythenbildung um das Réduit national und die vergangenheitspolitische Popularität des «Aktivdienstmodells» wirksam blockiert.47
Dies war deshalb problematisch, weil sich die Schweiz auch nach dem Zweiten Weltkrieg «der Entwicklung in der modernen Kriegsführung keineswegs entziehen» konnte.48 Diese perzipierte man nach 1945 stark unter dem operativ-waffentechnischen Aspekt. Über den Konzeptionenstreit zwischen «Stabilen» und «Mobilen» sowie weitere innere Konflikte hinaus träumte die schweizerische Armeeführung mehrheitlich von Atombomben, die als «moderne Hellebarden» zur Bekämpfung des Feindes im Mittelland eingesetzt werden sollten, von Hunderten von Kampfflugzeugen, die, wenn nötig, mit Atomwaffen in die strategische Tiefe des Ostblocks vordringen, und von hochmechanisierten Einheiten, mit denen feindliche Kräfte im «Kriegstheater» besiegt werden konnten. Der Fokus lag erneut auf militärischen Aspekten – die weiteren Zusammenhänge einer auf verschiedenen Stufen einer Konflikteskalation funktionierenden Landesverteidigung wurden weitgehend ausgeblendet. Dass diese Waffen-Aufrüstungspläne dann nicht verwirklicht werden konnten, war nicht Resultat besserer Einsicht, sondern einer opaken Mischung aus freundeidgenössischen Kompromissen, unternehmerischer Interessenpolitik und äusseren Zwängen geschuldet. Im Einzelnen zu nennen sind: Fehlende Finanzen auf Bundesebene, aussenwirtschaftliche Abhängigkeiten und Präferenzen (unter anderem Kauf von US-amerikanischen Leichtwasserreaktoren), multilaterale Verrechtlichungsprozesse im globalen Massstab (atomare Non-Proliferationsabkommen).49
Die Schweiz brachte sich mit diesen Lernschwierigkeiten, die mit einer Vereindimensionalisierung der Expertise zusammenhängen, «um die sicherheitspolitischen Früchte ihrer spezifischen und richtungsweisenden ‹Kriegserfahrung›» (so Wegmanns Schlussfolgerung).50 Zwar wurden im Verlaufe der 1970er-Jahre aussenwirtschaftspolitische Faktoren etwas stärker berücksichtigt. Doch von der Armeekonzeption 1966 über die Berichte zur Gesamtverteidigung von 1970 und 1973 bis hin zum Zwischenbericht 1979 sowie zum Bericht über die Friedens- und Sicherheitspolitik von 1988 lässt sich sagen, dass sie «um den Preis inhaltlicher Unschärfe und Unverbindlichkeit versuchten […] einen überparteilichen Konsens herzustellen» und dabei «oft als Referenz im innenpolitischen Kampf um Ressourcen» dienten.51
Im 21. Jahrhundert wurden diese Problemstellungen deutlicher freigelegt. In einer konzisen Abhandlung zur «Rohstoffpolitik als Sicherheitspolitik» arbeiteten Henrique Schneider und Hans-Ulrich Bigler die zentrale Bedeutung «weltweiter Rohstoff-Austauschketten» heraus, die einerseits Wohlstandsgewinne ermöglichen und andererseits eine steigende Verletzlichkeit implizieren.52 Die Autoren würdigen die bundesrätlichen Vorschläge zur Energiewende, konstatieren darin jedoch einen «logischen Fehler»: «Versorgungssicherheit wird nicht mittels Importen gewährleistet. Die Frage muss umgekehrt lauten, nämlich: Wie kann man Versorgungssicherheit trotz Importen garantieren?» Die Schweiz als «wirtschaftlich hochgradig vernetztes Land und arm an eigenen Rohstoffen» sei «auf einen freien internationalen Marktzugang generell angewiesen» und deshalb «in besonderem Mass exponiert gegenüber Druck oder Nötigung mit wirtschaftlichen Mitteln».53 Zwar wäre es «strategisch, ordnungs- und sicherheitspolitisch falsch, die Schweizer Aussenpolitik einseitig auf die Rohstoffbedürfnisse der Wirtschaft auszurichten»; daraus folge aber «keineswegs, dass sich die Aussenpolitik nicht dafür einzusetzen hätte».54 Eine solche «in einem weiten Sinne verstandene» Sicherheitspolitik, welche die Abhängigkeitsmatrix der Volkswirtschaft und den Manövrierspielraum international tätiger Unternehmen angemessen berücksichtigt, bleibt jedoch unvermeidlich einem nationalen Paradigma verhaftet; es geht darum, «die Sicherheit eines Staates» zu verknüpfen mit «seiner Fähigkeit, die Lebensqualität seiner Bevölkerung und seine eigene Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten».55 Dass die Vorbereitung auf einen Krisen- und Kriegsfall a priori nicht auf einen nationalen Handlungsraum beschränkt bleiben kann, wird durchaus mitgedacht. Doch die weitreichenden Konsequenzen dieser Einsicht bleiben auch hier unterbelichtet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im «kurzen 20. Jahrhundert» – also in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges – die für die nationale Selbstbehauptung der Schweiz als Kleinstaat im europäischen und internationalen Massstab so wichtige Wirtschaft ein blinder Fleck oder zumindest eine stark ausgeklammerte Dimension der «schweizerischen Erfahrung»56 war. Dies verfestigte in einer longue durée die immer wieder prekären Asymmetrien in der Landesverteidigungskonzeption. Es liegt hier allerdings ein Problem vor, das nicht einfach «lösbar» ist, denn die Aporie einer nationalen Antwort (wie sie im Begriff einer «Landesverteidigung» angelegt ist) auf eine transnationale Problemlage (wie sie in Begriffen wie «Verflechtung», «Abhängigkeit» und «Verletzbarkeit» zum Ausdruck kommen) lässt sich grundsätzlich nicht aufheben.