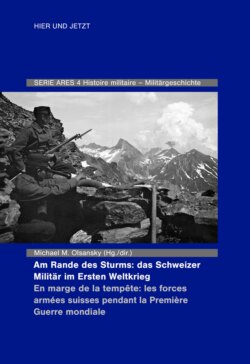Читать книгу Am Rande des Sturms: Das Schweizer Militär im Ersten Weltkrieg / En marche de la tempête : les forces armées suisse pendant la Première Guerre mondiale - Группа авторов - Страница 26
Lageentwicklungen und Eventualplanungen 1915–1918
ОглавлениеIm Januar 1915 wurde die Kavallerie-Division des 1. Armeekorps aufgelöst und die Verbände entlassen. Auch die Stäbe der Armeekorps 1 und 2 wurden nach Hause geschickt. Offenbar erwartete das Armeekommando aus Westen keine unmittelbare Bedrohung. Diese Situation gab nun Anlass zu allerhand Gedankenspielen. Im Juli hielt Generalstabschef Sprecher nach dem Kriegseintritt Italiens und den «Erfolge[n] der Zentralmächte an der Ostfront in zwei bis drei Monaten eine Offensive an der West- und Südfront» für möglich.10 Hinsichtlich der Bedrohung im Süden sah er die «nationalen Begehrlichkeiten dieses skrupellosen Staates Italien» für besonders gefährlich an und schlug eine Kräfteverschiebung an die West- und Südgrenze vor, um eine allfällige Gebirgsfront gegenüber Italien auf alle Fälle halten zu können.11 Dabei supponierte er ein Engagement der Deutschen gegen Frankreich an der Westfront und einen Diversionsangriff der Franzosen über die Schweiz, weil, «wie die militärische Lage heute ist, wir sicher sein können, bei drohendem Angriff von Westen die Hilfe Deutschlands zu erhalten, die notwendig ist, um auf diesem unserem Hauptkriegsschauplatz nicht nur standzuhalten, sondern offensiv vorzugehen.»12
General Wille hielt dagegen von den Überlegungen, wie die Kräfte an den verschiedenen Fronten zu dosieren wären, nichts und hielt die Lage im September 1915 für beruhigt. Er liess die Befestigungsarbeiten im Tessin einstellen, so wie er bereits gegen Ende 1914 die Arbeiten bei Les Rangiers hatte einstellen lassen.
In diesen Kontext muss auch der eingangs erwähnte Säbelrassler-Brief gestellt werden. Wille hat ihn am 20. Juli 1915 verfasst, also in einer Zeit, als die Dinge militärisch für die Zentralmächte zu laufen schienen, die Alliierten aber bereits auf die Karte Wirtschaftskrieg gesetzt hatten und die Schweiz zwangen, ihre Importe und Exporte kontrollieren zu lassen. In einer Lagebeurteilung vom 30. Juli hielt der Generalstabschef im selben Sinne fest, dass ein Gang über Schweizer Territorium bei einer deutschen Westoffensive eigentlich nur Frankreich strategische Vorteile bieten könne, falls die Vermehrung der Truppenbestände bei der Entente weitergehe.13 Ein Zusammengehen mit den Deutschen wurde also nur nach einem Angriff Frankreichs in Erwägung gezogen. Ein Kriegseintritt an der Seite des Deutschen Reiches ohne vorherige Neutralitätsverletzung war in keiner Weise vorgesehen, und es gibt keinerlei Hinweise, dass auch nur minime Planungsarbeiten dazu in Angriff genommen wurden.
Im Januar 1916 machte sich Wille sodann im Vorfeld der deutschen Offensivplanungen für die Westfront, die zeitweilig einen Angriff entweder über Belfort oder Verdun vorsahen, folgende Gedanken zu einer möglichen Bedrohung der Schweiz: Das «auf allen Kriegsschauplätzen bis dahin überlegene Deutschland [bedürfe] eines starken siegreichen Schlages gegen Frankreich», also könne eher von dort eine Umgehung über die Schweiz angenommen werden. Er hielt jedoch treffend fest, dass weder Frankreich noch Deutschland die nötigen Kräfte hätten, um eine solche Diversionsaktion in Szene zu setzen.14 Gegen Ende des Jahres 1916 wurden die Truppenbestände weiter zurückgefahren. An der Nord-West-Front standen nur noch 11 Bataillone. Dies veranlasste Wille zur Aussage, dass wir «in unserer gegenwärtigen Verfassung vollständig wehrlos wären, selbst ohne strategischen Überfall». Nur eine erneute Gesamtmobilmachung könne dies ändern.15
Um die Jahreswende 1916/17 wurde in der Schweizer Presse die Möglichkeit von französischen und vor allem deutschen Operationen über Schweizer Territorium intensiv behandelt. In der Literatur wird angemerkt, dass es zu einer «eigentlichen Kriegspsychose» gekommen sein soll, die absichtlich von Frankreich geschürt wurde, um gegen Deutschland Stimmung zu machen.16 Bereits angelaufen waren im Nachgang zur Oberstenaffäre die schweizerisch-französischen Generalstabsgespräche beziehungsweise Eventualallianzabsprachen. In der ersten Jahreshälfte 1917 kam es im Zusammenhang mit der Entwicklung an der Dolomiten-Front auch zu intensiveren Gesprächen zwischen dem österreichisch-ungarischen und dem schweizerischen Generalstab, welche zu einem Geheimabkommen (19. Juni 1917) über eine mögliche Kooperation im Kriegsfall mit Italien führten. Nach einer italienischen Offensive gegen die Schweiz sollten österreichisch-ungarische Truppen zur Verstärkung der schweizerischen Truppen einmarschieren, um das schweizerische Territorium zu verteidigen.17
Von grösserem Interesse ist nun, wie Wille und von Sprecher nach mehr als zweieinhalb Kriegsjahren beziehungsweise nach der Erfahrung der grossen Materialschlachten von 1916 bei Verdun und an der Somme bei einem Einfall der französischen Armee oder des deutschen Heeres operativ vorgehen wollten. Also in etwa zeitgleich, als die Nivelle-Offensive am Chemin des Dames geplant wurde und die Deutschen sich auf das Abfangen dieses französischen Angriffs einstellten. Sprecher stützte sich bei seinen Überlegungen auf Studien und Konzepte des im Februar 1917 ernannten Unterstabschefs Emil Sonderegger. Dieser liess in seine Studien selektiv jene Beobachtungen einfliessen, die Schweizer Offiziere in ihren Berichten von den Schauplätzen des Weltkrieges bis anhin zusammengetragen hatten.18 Sondereggers operative Vorbereitungen gingen sodann von Verteidigungslinien und verzögernden Kämpfen ab Landesgrenze auf allen Einfallachsen aus. Zwei Verteidigungslinien wurden dabei ins Auge gefasst: Les Rangiers–Jolimont–Thun und Wasserberg–Hauenstein–Napf.19
Diese operativen Studien wurden im Laufe des Jahres unter anderem in einer operativen Übung für die Fälle West und Nord vertieft. Nachdem Russland im Herbst 1917 aus dem Krieg ausgeschieden war, sah Generalstabschef Sprecher «Frankreichs Hoffnung dahinschwinden» und mahnte erneut, «gut gerüstet bereitzustehen»:
«Nach den Erfahrungen dieses Jahres darf eine solche Stellung nicht nur linear sein, sondern sie muss eine gewisse Tiefe haben und es müssen die aufeinander folgenden Linien durch seitliche Verriegelungen verstärkt und durch bombensichere Unterstände ergänzt werden. Es sollte deshalb zum mindesten das vollständige Gerippe der Stellungen, deren Tracé auf der ganzen Front durch Pikettierung und Vorgraben festgelegt und das Material an Ort und Stelle geschafft werden, damit nötigenfalls die Truppe, bei plötzlichem Aufgebote, sofort mit dem Ausbau beginnen könnte.»20
Die Kredite für das Material seien zum Teil bereits gewährt; wenn der Bundesrat die Ergänzungskredite bei Bedarf nicht sprechen würde, sei die Armeeleitung aus der Verantwortung, so von Sprecher. Wille stand dem allem grundsätzlich ablehnend gegenüber. Er hielt eisern an seinen längst vor dem Weltkrieg formulierten Grundsätzen fest: Er wolle keine bindenden Planungsvarianten und zusammen mit dem Feind des Feindes über den Aufmarsch situativ befinden: «Wo wir uns sammeln, das hängt davon ab, wann unser Alliierter über den Rhein kommen kann; ob wir uns sammeln […] das kann durch spätere Besprechungen geklärt werden; auch dafür ist das Planen und Handeln unseres grossen Alliierten bestimmend.»21 Dieser grosse Alliierte kam über den Rhein, wohlgemerkt. Wille wollte dem Gegner in der konzentrierten Feldschlacht begegnen, auch weil er den Grabenkrieg für die grösstenteils aus der Beurlaubung kommende Milizarmee für ungeeignet hielt: «Die Entscheidung muss in der offenen Feldschlacht des Bewegungskrieges gesucht werden, alle Faktoren für den Grabenkrieg, in dem unsere Gegner sich jetzt 2½ Jahre eingeübt haben, fehlen uns, oder sind wenigstens bei uns sehr unvollkommen und unfertig vorhanden.»22
Operative Studien des Unterstabschefs Emil Sonderegger aus dem Jahr 1917.
Hans Rudolf Fuhrer spricht treffend davon, dass «die grundsätzlich polaren Positionen in der Befestigungsfrage, der Kampfweise und der Unplanbarkeit des Krieges» zwischen Wille und von Sprecher wieder bezogen waren.23
Dass die Schweiz nicht über längere Zeit einen Graben- und Abnützungskrieg führen konnte, darin lag Wille sicher richtig. Das industrielle Potenzial dazu fehlte völlig, es war ja nicht einmal für die grosse Feldschlacht genügend Munition vorhanden.24
Für Wille war es aber auch nicht begreifbar, dass Kriege durch industrielle Potenziale entschieden werden konnten. Sein ceterum censeo war «Erziehung und Ausbildung», wann immer er Bauarbeiten einstellen liess. So wie er der Aussage Bundesrat Schultheissens im August 1914, Deutschland werde den Krieg an der Wirtschaftsfront verlieren, mit Vehemenz entgegentrat, rechnete er den Deutschen in seinen Kriegslehren von 1924 vor, sie hätten es an der Marne so machen müssen wie 1870 und mehr «Manneswesen» zeigen müssen.25 Er glaubte daran, dass die besser erzogenen und besser geführten Soldaten den Krieg gewinnen werden, so wie die Deutschen 1914 und 1939 daran glaubten, die besseren Soldaten und Offiziere würden den Krieg gewinnen.
Nach 1917 ergab sich keine Lageentwicklung mehr, welche Umdispositionen der nur noch schwach mobilisierten Armee erfordert hätten und die operativen Absichten beziehungsweise Positionen nochmals grundlegend in Frage gestellt hätten. Daran änderten auch die 1918 auf Divisionsstufe durchgeführten Experimente mit Sturmabteilungen und die Konterrevolutionsplanungen des Unterstabschefs de Perrot nichts.26
Ein grundlegender Konsens wirkte jedoch bis im Juni 1940 nach: Die Schweizer Armee ist auf einen Allianzpartner angewiesen, wenn sie gegen einen ernsthaften Gegner bestehen will.