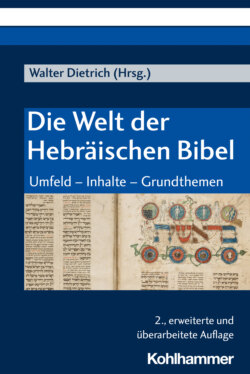Читать книгу Die Welt der Hebräischen Bibel - Группа авторов - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Warum Geschichte nicht objektiv sein kann
ОглавлениеWenn über das Verhältnis von Bibel und Geschichte nachgedacht werden soll, ist die erste Frage, was eigentlich Geschichte ist. Darauf gibt es viele unterschiedliche Antworten, und alle sind bedeutsam für die Frage des Verhältnisses von Bibel und Geschichte. Schauen wir auf zwei grundlegende Verständnisse von Geschichte und beginnen mit dem umfassendsten: Geschichte ist das Vergangene, also die Summe all dessen, was gewesen ist. In dieser umfassenden Antwort zeigt sich schon, dass das Reden über Geschichte einen Standort voraussetzt, von dem aus man etwas als Geschichte versteht, und dass sich dieses Etwas von der Gegenwart kategorial durch das Davor unterscheidet. Zugleich leuchtet unmittelbar ein, dass diese Geschichte mehr ist als das, was man fassen kann. Selbst die umfassendste Vorstellung von big data reicht nicht hin, dass die Gesamtheit des Geschehenen in Raum und Zeit gespeichert werden könnte. Die Vergangenheiten als Gesamtheit des Geschehenen sind unwiederbringlich vergangen! So banal diese Einsicht klingt, so ist sie doch der Ausgangspunkt für eine differenziertere Sicht auf das, was Geschichte ist. Denn wenn das Geschehene auch im optimalen Fall nicht wieder in der Form von uns präsent gehalten werden kann, in der es zuvor war, eröffnet sich der Blick auf ein zweites Verständnis. Geschichte ist dann das, was von dem Vergangenen in der Gegenwart präsent gehalten wird. Während in dem ersten Verständnis Geschichte und Geschehen identisch waren, treten die beiden Größen in dem zweiten Verständnis auseinander. Entscheidend wird nun die Differenz: Der einen Geschichte stehen die vielen Geschichten gegenüber.57 »Erzähl mir deine Geschichte!« meint nicht die Summe des Erlebten, sondern eine Auswahl des Geschehenen, die in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht und als Ereignisfolge erzählt wird. Von zentraler Bedeutung ist dabei das Moment der Auswahl des Erlebten, auf das nur über die subjektive Erfahrung des Erzählenden zugegriffen wird. Geschichte in diesem Sinne ist immer selektiv und immer subjektiv. Sie setzt die Gegenwart in ein Verhältnis zur Vergangenheit, indem sie in der Geschichte einen Bezug zu den Vergangenheiten, die vergangen sind, herstellt. Dabei ist es nicht nur das Wissen von dem Geschehenen, sondern vielfach auch das Nicht-Wissen, das den Zugriff auf das Vergangene bestimmt. Das wissen wir aus unserem eigenen Erzählen: Nicht alles, was als Geschichte in der Gegenwart präsent gehalten wird, ist auch geschehen. Indem die Geschichte die Vergangenheit mit der Gegenwart unlösbar verknüpft, verbindet sie das Gewesene zu einem dichten Gewebe, so dass man von einer Textur (lat. textus – »Gewebe, Geflecht«) sprechen kann. Geschichte ist eine selektive, perspektivische und absichtsvolle Textur der Vergangenheit. In der Verknüpfung der Ereignisse wird das Geschehen auf die Gegenwart hin als sinnhaft konstituiert. Der bedeutungsvolle Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart, der über den bloßen Lauf der Zeit hinausgeht, ist in und durch die Geschichte geschaffen. Geschichte schafft Kohärenz (von lat. cohaerere – »zusammenhängen«). Geschichte ist immer eine Deutung der Vergangenheit und eine der ganz wesentlichen Sinnressourcen in der Deutung des Lebens. Indem die Gegenwart auf die Zukunft gerichtet und in den Kontext der Vergangenheiten gestellt und so ein Zusammenhang (eine Kohärenz im Gefüge der Zeit) geschaffen wird, findet schon eine Sinnstiftung statt.
Mit der Einsicht, dass Geschichte nicht identisch mit dem Geschehenen ist und es keine objektive Geschichte gibt, sondern sich Geschichte im Bezug auf das Vergangene als eine subjektiv gebrochene Konstruktion und Selektion erweist, brechen Spannungen auf. Vor allem stellt sich die Frage, wie es sich mit der Wahrheit der Geschichte verhält, wenn diese nicht mit dem Geschehenen identisch ist. In einem landläufigen Verständnis ist nur das wahr, was gewesen ist, und was nicht gewesen ist, kann nicht wahr sein. Darin unterscheiden sich Fakten und Fiktionen oder Geschichte und Geschichten.
Noch einmal zurück zu der Aufforderung »Erzähl mir deine Geschichte!« Wir erwarten dabei, dass das Gegenüber nicht flunkert, sondern die Dinge, wie sie sich zugetragen haben, wahrheitsgetreu wiedergibt. Und unter dieser Voraussetzung wollen wir das, was erzählt wird, für wahr halten. Da wir über stimmige Erzählungen in unserer Welt Kohärenz erzeugen, ist das nur allzu natürlich. Und dabei übersehen wir mit großer Regelmäßigkeit eine ganz zentrale und wichtige Grundunterscheidung: dass nämlich »wahr« und »historisch« nicht das Gleiche sind und dass das, was Wahrheit beansprucht, nicht notwendig geschichtlich gewesen sein muss. Das, was gewesen ist, ist in einer besonderen ureigenen Weise wahr, doch sind die Vergangenheiten vergangen, und diese ureigene Weise des Wahren und Unverfälschten ist unserem Zugriff entzogen. Unser Griff nach der Vergangenheit ist ein Griff nach den Schatten, die diese geworfen hat. Wir bekommen sie nicht mehr zu fassen, was uns zwingt, das Gewesene immer neu zu konstruieren und die Konstruktion zur Wahrheit zu erheben. Doch es bleibt dabei: Das Gewesene und das im Erzählen Gewordene ist nicht das Gleiche. Wahr ist nicht nur das, was war, sondern Wahrheit gibt es auch in dem, was sich von dem Gewesenen entfernt und die Schatten der Vergangenheit mit dem Licht der Erzählung überblendet. Die Wahrheit des Erzählten entdeckt sich sogar nur dann, wenn sich die Betrachtung von dem Anspruch löst, das Erzählte als bloßes Abbild des Gewesenen zu betrachten.