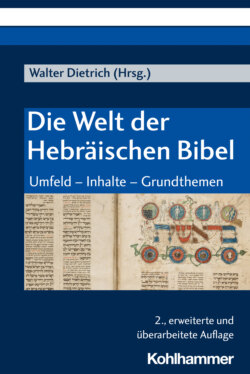Читать книгу Die Welt der Hebräischen Bibel - Группа авторов - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Das Schreibmaterial
ОглавлениеDie biblischen Texte sind im Verlauf ihrer Überlieferung wieder und wieder abgeschrieben worden, bis zu jenen Handschriften, auf denen unsere heutigen Textausgaben basieren. Die Anfänge dieser Textproduktion liegen im Dunkeln, so dass man nur vermuten kann, welches der in der Antike zur Verfügung stehenden Schreibmaterialien damals verwendet wurde. Beginnt man mit den in der Bibel selbst genannten Materialien, so ist zunächst an die Schriftrolle zu denken. Eine solche wird etwa dem Propheten Ezechiel gereicht, der sie dann sogar aufessen muss (Ez 2,9–3,2). Breit wird in Jeremia 36 erzählt, dass der Prophet seine Weissagungen auf eine Schriftrolle schreibt, aus der dann sein Schreiber Baruch dem König alles vorliest. Dieser jedoch schneidet die vorgelesenen Spalten ab und verbrennt sie. Es ist anzunehmen, dass eine solche Rolle aus Papyrus angefertigt war, der seit dem 3. Jt. in Ägypten als Schreibmaterial verwendet wurde. Da die Papyrusstängel mehrere Meter lang werden können, eigneten sich solche Schriftrollen auch für längere Texte. Haupthandelsplatz für Papyrus war in der Antike die Stadt Byblos in Phönizien. Von ihrem Namen leitet sich das griechische Nomen biblion als Bezeichnung für eine Papyrus-Rolle ab; der Plural biblia bezeichnet dann später im Christentum die Sammlung der biblischen Bücher. Auch Leder konnte zur Produktion von Schriftrollen verwendet werden; belegt ist es im 5. Jh. in der bereits genannten jüdischen Siedlung auf Elephantine. Lederrollen sind in der Herstellung deutlich teurer, allerdings können sie durch Aneinandernähen von Stücken länger werden, und sie sind dauerhafter. In Palästina haben sie sich erst spät durchgesetzt; in Qumran sind Papyrusrollen weit in der Überzahl.
Die Verwendung von solchen Rollen hatte Konsequenzen für die Überlieferung der auf sie geschriebenen Texte: Zum einen war das Material bei Feuchtigkeit empfindlich und wenig dauerhaft, daher sind antike Papyrus- oder Lederrollen nur aus sehr trockenen Gebieten wie Ägypten oder der judäischen Wüste erhalten. Zum anderen war die Textmenge beschränkt, die auf eine solche Rolle geschrieben werden konnte. Die längsten in Qumran gefundenen Rollen (Tempelrolle und Jesaja) sind etwa 8 Meter lang, sie konnten also maximal ein (langes) biblisches Buch aufnehmen. Das bedeutet, dass größere Schriftkompositionen in der Antike auf mehrere Rollen verteilt werden mussten – daher der Name »Pentateuch« für das Gefüge der fünf Rollen, die die Tora bilden. Zu bedenken ist außerdem, dass es vor der Erfindung des Codex (um die Zeitenwende) physisch keine »Bibel« gegeben haben kann, in der alle Schriften vereint waren.
Neben den Schriftrollen werden im AT auch Tafeln als Schreibmaterial genannt, am prominentesten sind die »Tafeln des Zeugnisses«, die Gott Mose auf dem Sinai gibt (Ex 31,18). Solche Steintafeln bzw. beschriftete Steine oder behauene Stelen in verschiedenen Größen wurden mit Meißeln oder Griffeln beschrieben. Antike Beispiele wurden mehrfach in Israel und seiner Umwelt gefunden. Erwähnenswert sind etwa die Inschrift auf der Stele des Königs Mescha aus Moab (um 840 v. Chr.) oder die auf dem Tel Dan gefundene aramäische Inschrift (9./8. Jh.) mit der ersten außerbiblischen Erwähnung der Davidsdynastie; beide Monumentalinschriften sind für die Rekonstruktion der Geschichte Israels von höchster Bedeutung. In Dtn 27,2 wird als weitere Methode der Beschriftung von Steinen genannt, dass sie mit Kalk übertüncht werden. Auf diese Weise konnten die Steine mit Pinsel und Farbe beschriftet werden. Die in Jes 30,8 oder Hab 2,2 genannten Tafeln können mit Wachs bestrichene Holztafeln gewesen sein, die man für schnelle Notizen nutzen und danach wiederverwenden konnte.
Ebenfalls für kurze Nachrichten, Briefe, Schreibübungen oder Notizen aller Art verwendet wurden sogenannte Ostraka. Das sind Scherben gebrannter und dann außer Gebrauch gekommener Krüge etc., die man mit Pinseln oder Griffeln beschriftet hat. Sie sind in großer Zahl erhalten, u. a. aus Samaria, der letzten Hauptstadt des Nordreichs Israel (8. Jh.), aber auch aus Lachisch im Südreich (6. Jh.). Aus Lachisch ist beispielsweise ein Brief erhalten (Ostrakon Nr. 3) in dem in Zeile 20f. ein Prophetenwort »Sei vorsichtig!« erwähnt wurde.112 Es ist denkbar, dass einzelne Aussprüche biblischer Propheten auf diese Weise in Israel zirkulierten. Die Ostraka gewähren vielfältige Einblicke in das tägliche Leben im damaligen Israel, daher sind sie für die Sozialgeschichtsschreibung von Bedeutung.
Schließlich sind Wandinschriften zu nennen, auch wenn sie in der Bibel nur mit der berühmten Menetekel-Inschrift im Palast des Belsazzar Erwähnung finden (Dan 5). So ist in dem Tunnel, den König Hiskija 701 v. Chr. zur Sicherung der Wasserversorgung Jerusalems anlegen ließ (2Chr 32,30), die sog. Siloah-Inschrift angebracht worden, die von den Arbeiten der Mineure berichtet. Noch bemerkenswerter ist die auf eine verputzte Wand geschriebene Bileam-Inschrift, die im jordanischen Deir Alla gefunden wurde und schon aus dem 9. oder 8. Jh. stammt. Sie berichtet von den Visionen eines Sehers namens Balaam, der offenkundig mit dem biblischen Bileam (Num 22–24) zu identifizieren ist. Bei dem Text handelt es sich um eine kunstvolle literarische Komposition, die belegt, dass bereits zu dieser Zeit Aussprüche von prophetischen Gestalten gesammelt, redigiert und einer lesekundigen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Man kann überlegen, ob nicht in der Bibel erwähnte Schriften wie etwa das »Buch des Aufrechten« (Jos 10,13) oder das »Buch der Chronik der Könige Israels« (1Kön 14,19) ebenfalls – zumindest in Auszügen – als Wandinschrift sichtbar waren. Andere wichtige Wandinschriften wurden in Kuntillet Adjrud im Süden Israels gefunden (9. Jh.), auch in einem Grab in Chirbet el Qom bei Hebron (8. Jh.). Sie geben Einblicke in die religiöse Vielfalt der mittleren Königszeit in Israel, etwa durch die Erwähnung von »Jhwh und seiner Aschera« in Chirbet el Qom, die auch auf einem Krug aus Kuntillet Adjrud belegt ist.
Auf ein ganz besonderes Material geschrieben war der einzige auch aus der Bibel bekannte Text, den man bisher bei Ausgrabungen gefunden hat: Der aaronitische Segen aus Num 6,24–26 war in kleine Silberstreifen eingeritzt und wohl im 6. Jh. einem Verstorbenen in sein Grab in Jerusalem mitgegeben worden.