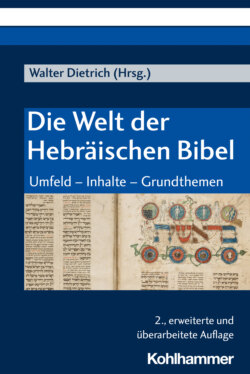Читать книгу Die Welt der Hebräischen Bibel - Группа авторов - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Der Masoretische Text
ОглавлениеDie heutigen Ausgaben der hebräischen Bibel basieren auf Texten, die aus dem Mittelalter stammen. Der älteste vollständige Bibelcodex ist eine in St. Petersburg aufbewahrte Handschrift aus dem Jahr 1008. Etwas ältere und z. T. noch sorgfältiger gearbeitete Handschriften wie der berühmte Aleppo-Codex sind leider unvollständig. Vergleicht man diese Texte etwa mit den Fragmenten der Rolle des Zwölfprophetenbuches aus dem Wadi Muraba‘at (1./2. Jh.), so stellt man fest, dass der Konsonantenbestand fast identisch ist; über ca. 1000 Jahre und viele Abschreibergenerationen hinweg wurde der Text minutiös bewahrt. Verantwortlich dafür ist ein Überlieferungssystem, das man »Masora« nennt, abgeleitet vom hebräischen Verbum masar – »weitergeben«. Die Träger dieser Tradition werden dementsprechend Masoreten genannt.
Die Arbeit ihrer Vorläufer setzte offenbar schon sehr früh ein, als die Rabbinen sich nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. darum bemühten, die Überlieferungen des Judentums zusammenzuhalten und den neuen Erfordernissen anzupassen. In dieser Zeit entstanden neben den Auslegungen der Schrift in der Mischna erste Sammlungen von Beobachtungen an Textphänomenen, um den Bestand des Bibeltextes zu sichern. So werden im Talmud an einzelnen Stellen die Zahl der Verse der biblischen Bücher mitgeteilt oder Hinweise zur Verwendung von Vokalbuchstaben gegeben. Wahrscheinlich ab dem 7. Jh. werden dann die Konsonantentexte mit Vokalzeichen versehen, um die Aussprache zu sichern (s. o.). Allerdings beschränkten sich die Masoreten nicht nur darauf, die Texte zu vokalisieren. Sie entwickelten auch Akzentsysteme, mit denen sowohl Betonungen als auch grammatikalisch-syntaktische Hinweise zum Verständnis des Textes gegeben wurden. Noch komplexer war ein Anmerkungsapparat, in dem alle irgendwie charakteristischen Textphänomene festgehalten wurden, von singulären Schreibweisen bis zu möglichen Schreibfehlern oder Korrekturvorschlägen. Auch wird am Ende jedes Buches die Zahl seiner Verse mitgeteilt; am Ende der Tora ist zu Dtn 34,12 vermerkt, dass es in der Tora 79.856 Wörter und 400.945 Konsonanten gibt. Solche Angaben dienten der Überprüfung und Korrektur der Handschriften.
Auf die Arbeit der Masoreten ist auch eine Fehllesung zurückzuführen, die bis heute für Irritationen sorgt: Da der Gottesname Jhwh nach der Zerstörung des Tempels nicht mehr ausgesprochen werden durfte, er aber im Bibeltext fast 7000mal zu lesen war, vokalisierten ihn die Masoreten mit den Vokalzeichen für Adonaj – »Herr«. Dabei entstand die Kombination Jehowah (mit Lautwechsel in der ersten Silbe von a zu e), von der jüdische Leser wussten, dass sie als Adonaj auszusprechen ist. Christliche Leser hielten dieses Wort aber fälschlich für den Gottesnamen. Viele moderne Bibelübersetzungen kennzeichnen dieses masoretische Phänomen dadurch, dass sie im Alten Testament »Herr« in Kapitälchen setzen (Herr) und so sichtbar machen, dass hier im hebräischen Text der Gottesname steht.
Im Mittelalter hat es verschiedene Schulen von Masoreten gegeben, sowohl in Babylon als auch in Palästina und dort besonders in Tiberias. Sie haben unterschiedliche Systeme der Vokalisation, Akzentuierung und der Anmerkungen entwickelt. Durchgesetzt hat sich schließlich die Tradition der Familie Ben Ascher aus Tiberias, aus deren Hand die besten Codices stammen, die im 10. und frühen 11. Jh. geschrieben wurden. Erst zu dieser Zeit war demnach die Hebräische Bibel, wie wir sie heute kennen, erstmals vollständig fertig.