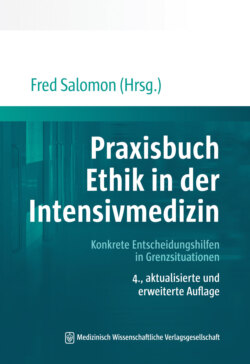Читать книгу Praxisbuch Ethik in der Intensivmedizin - Группа авторов - Страница 80
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8.2.5 Formen des Patientenwillens
ОглавлениеAktuell geäußerter Behandlungswunsch/-verzicht
Auch auf der Intensivstation wird der Arzt in nicht wenigen Fällen die Möglichkeit haben, noch mit dem Patienten selbst über dessen Erkrankung, die Behandlungsoptionen und dessen (Nicht-)Behandlungswünsche zu sprechen. Es handelt sich dann um den idealen Fall einer in Bezug auf eine konkrete und aktuelle Krankheitssituation vom äußerungsfähigen Patienten erklärte Behandlungseinwilligung oder -verweigerung bzw. um eine Kombination aus beiden (z. B. Schmerzlinderung ja, Reanimation nein). Sofern der Patient einwilligungsfähig ist, sind diese Äußerungen verbindlich, gehen einer ggf. vorhandenen Patientenverfügung vor und gelten auch dann fort, wenn der Patient im weiteren Verlauf entscheidungsunfähig wird (§ 130 Abs. 2 BGB). Insofern bedürfte es auch keiner Vertreterbestellung. Ist jedoch schon ein Betreuer oder Bevollmächtigter eingesetzt, liegt es auch in der Verantwortung dieser Personen, den Patientenwillen umzusetzen (s. Kap. 8.2.6).
Konnte eine Entscheidung des Patienten nicht (mehr) eingeholt werden, bleibt gleichwohl der Patientenwille in seinen weiteren, im Verhältnis zur aktuellen Willensäußerung subsidiären Erscheinungsformen maßgeblich, nämlich als entweder vorausverfügter oder in einem früheren Behandlungswunsch geäußerter oder mutmaßlicher Patientenwille. Entgegen einer immer noch anzutreffenden Auffassung führt der Verlust der Äußerungsfähigkeit also dazu, dass nunmehr der Arzt oder die Angehörigen nach ihren eigenen Vorstellungen über die Behandlung des Patienten entscheiden dürfen. Vielmehr muss nun auf anderem Wege versucht werden herauszufinden, welche Behandlung dem Willen des Patienten entspricht und dabei kann den Angehörigen eine entscheidende Rolle zukommen.
Patientenverfügung
Als solche Erkenntnisquelle kommt zunächst eine vom Patienten verfasste Patientenverfügung in Betracht. Die erhebliche Rechtsunsicherheit, die früher im Hinblick auf die Verbindlichkeit solcher Vorausverfügungen bestanden hat, ist durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene „Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts“ (BGBL I S. 2286) weitgehend beseitigt worden. Nunmehr bestimmt 1901 a Abs. 1 BGB, dass schriftliche Festlegungen, die ein einwilligungsfähiger volljähriger Patient im Hinblick auf bestimmte Behandlungen getroffen hat, dann zu befolgen sind, wenn sie auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn der Patient von dem Recht Gebrauch gemacht hat, seine Verfügung jederzeit formlos zu widerrufen. In § 1901 a Abs. 3 BGB wird klargestellt, dass die Bindungswirkung „unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung“ besteht. Damit wurde der langjährige, durch eine Entscheidung des 12. Zivilsenat des BGH vom 17. März 2003 [BGHZ 154, 205, 214 f.] ausgelöste Streit über die sog. Reichweitenbeschränkung (Verbindlichkeit von Patientenverfügungen nur bei irreversibel tödlichen Krankheitsverläufen) zu Gunsten einer praktikablen selbstbestimmungsfreundlichen und mit der Rechtsprechung des BGH in Strafsachen übereinstimmenden Lösung entschieden (vgl. Kap. 9.3 „Patientenverfügungen“).
Diese begrüßenswerte gesetzliche Absicherung von Patientenverfügungen führt nicht dazu, dass Ärzte und Patientenvertreter nunmehr jede auch noch so unvernünftig erscheinende Verfügung umsetzen müssten oder aber – solche Fälle wurden den Autoren berichtet – allein aus der bloßen Existenz eines mit ,Patientenverfügung‘ überschriebenen Schriftstücks eine Berechtigung zur Behandlungsbegrenzung ableiten dürfen. Vielmehr muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Voraussetzungen von § 1901 a Abs. 1 BGB erfüllt sind. Da Zweifel an der Authentizität der Verfügung und der seinerzeitigen Einwilligungsfähigkeit des Patienten eher selten sein dürften und auch nur bei konkreten Anhaltspunkten berechtigt sind, kommt es entscheidend auf die Beurteilung an, ob die Patientenverfügung hinreichend konkret und situationsbezogen ist und noch dem aktuellen Willen des Patienten entspricht. Erfahrungsgemäß erfassen Patientenverfügungen die tatsächlich eingetretene Erkrankungs- und Behandlungssituation nicht immer zu 100 %, so dass sich die Notwendigkeit ihrer Auslegung unter Heranziehung der Informationen ergibt, die über die Wünsche, Einstellungen und Präferenzen des Patienten bekannt sind. Wie die neuere Rechtsprechung des BGH in Zivilsachen zeigt, bestehen dabei rechtlich nicht exakt eingrenzbare Auslegungsspielräume. So hat der 12. Zivilsenat in einer Entscheidung aus 2014 (BGHZ 202, 226, 229) zutreffend darauf hingewiesen, dass „die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung (…) nicht überspannt werden“ dürfen und nicht „ein gleiches Maß an Präzision verlangt“ werden kann wie bei einer aktuell abgegebenen Willensäußerung. In einer Entscheidung aus 2016 (BGHZ 211, 67; s. Fallbeispiel) hat er die Bestimmtheitsanforderungen dagegen wieder verschärft, doch muss dieser Beschluss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass es darin um die Einsetzung einer Kontrollbetreuung trotz einer wirksam erteilten Bevollmächtigung ging. In einer 2018 ergangenen Entscheidung (BGH, NJW 2019, 600) hat der 12. Zivilsenat wiederum weniger strenge Maßstäbe angelegt. So könne der als solches zu unspezifische Verzicht auf „lebensverlängernde Maßnahmen“ dann eine ausreichende Grundlage für eine Behandlungseinstellung bei einer Wachkomapatientin sein, wenn er sich auf die in der Patientenverfügung genannte Behandlungssituation bezieht, dass „keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht“ und sich gegebenenfalls weitere Anhaltspunkte für diese Auslegung der Patientenverfügung finden.
Fallbeispiel
Die Patientin erlitt im Alter von 70 Jahren einen Hirnschlag und wurde seitdem in einem Pflegeheim mittels PEG ernährt und medikamentös behandelt. Infolge einer danach aufgetretenen Phase epileptischer Anfälle ist sie nicht mehr kommunikationsfähig. In ihrer Patientenverfügung wünscht sie u. a. „daß lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn medizinisch eindeutig festgestellt ist, daß aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibt.“ Der BGH hält diese Formulierungen für zu unbestimmt, um daraus abzuleiten, dass sich die Bevollmächtigte mit ihrer im Einvernehmen mit der Hausärztin getroffenen Entscheidung, die künstliche Ernährung nicht einzustellen, über den Willen der Patientin hinwegsetzt hat (BGHZ 211, 67).
Behandlungswünsche und mutmaßlicher Patientenwille
Für den Fall, dass keine oder nur eine den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprechende Patientenverfügung vorliegt, bestimmt § 1901a Abs. 2 BGB, dass die Behandlungswünsche oder der mutmaßliche Wille des nicht mehr äußerungsfähigen Patienten festzustellen und zu beachten sind. In der bereits genannten Entscheidung aus dem Jahr 2014 hat sich der 12. Zivilsenat erstmals zum Verhältnis dieser beiden Erscheinungsformen des Patientenwillens geäußert. Danach sind Behandlungswünsche „Festlegungen für eine konkrete Lebens- und Behandlungssituation“, die aber den Anforderungen an eine Patientenverfügung nicht entsprechen, etwa weil sie nicht schriftlich verfasst wurden oder nicht passgenau sind. Solche Wünsche seien „insbesondere dann aussagekräftig, wenn sie in Ansehung der Erkrankung zeitnah geäußert worden sind, konkrete Bezüge zur aktuellen Behandlungssituation aufweisen und die Zielvorstellungen des Patienten erkennen lassen“. Demgegenüber beruhe die Ergründung des mutmaßlichen Willens auf weniger konkreten früheren Äußerungen und den allgemeinen Überzeugungen und Wertvorstellungen des Betroffenen. Bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens geht es allein um die Frage, wie der Patient voraussichtlich entscheiden würde, wenn er sich jetzt noch äußern könnte. Die Eruierung des mutmaßlichen Willens ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der die Gefahr besteht, dass Wertvorstellungen und Wünsche Dritter in die Beurteilung einfließen. Maßstab sind aber wiederum nur die ganz individuellen Einstellungen und Präferenzen des Patienten, mögen diese auch in den Augen anderer unvernünftig sein [BGHSt 35, 249; 40, 257, 263]. § 1901 a Abs. 2 BGB stellt insoweit klar, dass es auf „konkrete Anhaltspunkte“ ankommt und „insbesondere frühere mündliche, oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugen und sonstige Wertvorstellungen“ zu berücksichtigen sind.
Durch die gesetzliche Hervorhebung der Behandlungswünsche ergibt sich nunmehr ein vierstufiger Algorithmus der Willensermittlung: Stets vorrangig ist der aktuell erklärte Wille des einwilligungsfähigen Patienten, falls der nicht (mehr) erklärt werden kann, kommt es auf eine verbindliche Patientenverfügung an, liegt eine solche nicht vor, sind frühere konkrete Behandlungswünsche zu beachten, fehlen solche, ist der mutmaßliche Patientenwille maßgeblich.
Sollte die Willens- und Werteanamnese kein klares Bild ergeben, gehen die Meinungen über die nunmehr anzulegenden Maßstäbe auseinander und besteht somit ein rechtlich nicht eindeutig vorstrukturierter, gleichwohl auszufüllender Entscheidungsraum. So finden sich Stimmen, die nach der Präferenzregel „in dubio pro vita“ verfahren wollen und den Arzt zur Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen verpflichtet sehen [Höfling 2008]; andere betonen dagegen die Legitimationsbedürftigkeit jeder Behandlung und die Entscheidungsmaxime „in dubio pro dignitate“ [Lipp 2008]. Zwar hat auch der Bundesgerichtshof [BGHSt 40, 257, 263] hervorgehoben, dass an die Annahme eines mutmaßlichen Nichtbehandlungswunsches strenge Anforderungen zu stellen sind und der Schutz des menschlichen Lebens im Zweifel „Vorrang vor persönlichen Überlegungen des Arztes, des Angehörigen oder einer anderen Person (hat)“. Zugleich sieht der Bundesgerichtshof aber Raum für den Rückgriff auf „allgemeine Wertvorstellungen“ und hält einen Behandlungsabbruch um so eher vertretbar, „je weniger die Wiederherstellung eines nach allgemeinen Vorstellungen menschenwürdigen Lebens zu erwarten ist und je kürzer der Tod bevorsteht.“
Im Ergebnis dürfte damit ein Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum eröffnet sein, innerhalb dessen sowohl eine (Weiter-)Behandlung als auch eine Behandlungsbegrenzung vertretbar sein können und der deutliche Überschneidungen mit einem auch ethische Wertungen umfassenden Verständnis des Begriffs der medizinischen Indikation hat [Verrel 2007]. Die letztlich getroffene Entscheidung muss in jedem Fall auf einer soliden medizinischen Grundlage (Diagnose, Prognose) und einer nachvollziehbaren, nicht von sachfremden Erwägungen getragenen Begründung beruhen, die wiederum gut dokumentiert werden sollte. Eine derartige Entscheidungsfindung wird am ehesten gelingen, wenn darin alle an der Behandlung beteiligten Personen sowie die Vertreter und Angehörigen des Patienten eingebunden werden [Salomon u. Salomon 2008]. Ein Ethikkonsil bzw. eine ethische Fallbesprechung wird zunehmend als hilfreich angesehen. Diese Überlegungen leiten zu der nächsten, von der Maßgeblichkeit des Patientenwillens und der Notwendigkeit seiner Erforschung zu unterscheidenden Frage über, wer von Rechts wegen zur Bestimmung und Umsetzung des Patientenwillens berufen ist.
Fallbeispiel
Die 72-jährige Patientin litt an einem ausgeprägten hirnorganischen Psychosyndrom im Rahmen einer präsenilen Demenz mit Verdacht auf Morbus Alzheimer. Durch einen Herzstillstand mit anschließender Reanimation war sie irreversibel schwerst cerebralgeschädigt. Eine daraus resultierende Schluckunfähigkeit machte die künstliche Ernährung der nicht mehr ansprechbaren, geh- und stehunfähigen Patientin erforderlich. Nach zweieinhalbjähriger, keine Besserung mehr versprechender Behandlung kamen der behandelnde Arzt und der zu ihrem Betreuer bestellte Sohn der Patientin überein, die Sondenernährung bei Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr zu beenden. Jedoch weigerte sich das Pflegepersonal, die entsprechende Anweisung im Verordnungsblatt zu befolgen. Das vom Pflegedienstleiter verständigte Vormundschaftsgericht (heute: Betreuungsgericht) versagte die Genehmigung der Ernährungseinstellung. Der Arzt und der Sohn wurden in erster Instanz wegen versuchten Totschlags zu Geldstrafen verurteilt. Der BGH hob diese Verurteilung u. a. wegen unzureichender Feststellungen zum Vorliegen eines mutmaßlichen Behandlungsverzichts auf [BGHSt 40, 257, 265]. Das Verfahren endete mit einem Freispruch der Angeklagten, da das nunmehr mit der Sache befasste Gericht ausreichende Anhaltspunkte für eine mutmaßliche Einwilligung der Patientin in den Ernährungsabbruch sah, die vor vielen Jahren geäußert hatte, dass sie nicht als schwerer Pflegefall enden wolle [LG Kempten, Urteil vom 17.5.1995 – KS 13 Js 12155/93].