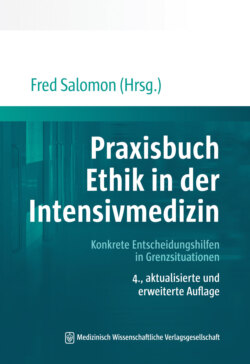Читать книгу Praxisbuch Ethik in der Intensivmedizin - Группа авторов - Страница 82
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8.2.7 Suizid
ОглавлениеNicht nur ethisch umstritten, sondern auch strafrechtlich heikel ist der Umgang mit Suizidpatienten. Dabei sind zwei Konstellationen zu unterscheiden. Die erste, klinisch relevantere betrifft die Behandlung eines Patienten nach Suizidversuch, die zweite, derzeit im Fokus der Reformdiskussion stehende Konstellation ist die der vom Patienten erbetenen ärztlichen Suizidassistenz.
Der erstgenannte Fall hat zwar rechtlich insoweit eine Klärung erfahren, als die freiverantwortlich gefasste Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, von BVerfGE 153, 182 als Ausdruck grundrechtlich geschützter Selbstbestimmung gesehen wird und daher zu respektieren ist. Außerdem hat der BGH bereits zuvor seine aus dem Jahr 1984 stammende Rechtsprechung, nach der ein Arzt auch bei einem freiverantwortlichen Suizidversuch grundsätzlich zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet ist [BGHSt 32, 276], in zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2019 [BGHSt 64, 121 u. 135], zurückgenommen, wenn auch nicht in der wünschenswerten Deutlichkeit. Doch dürfte es für den mit einem Suizidpatienten konfrontierten Arzt in den meisten Fällen gar nicht möglich sein zu prüfen, ob ein nach den Erkenntnissen der Suizidforschung ohnehin extrem seltener Fall einer wohl überlegten Entscheidung vorliegt, die „von einer gewissen ‚Dauerhaftigkeit‘ und ‚inneren Festigkeit‘ getragen ist“ (BVerfGE 153, 182, 247). Unterbleibt die mögliche Rettung eines unfrei handelnden Suizidenten, steht für den Arzt nicht nur eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung, sondern sogar wegen Totschlags durch Unterlassen im Raum. Daher dürfte und sollte die Behandlung des Suizidpatienten der Regelfall sein. Wie die beiden Entscheidungen des BGH aus 2019 zeigen, können die Dinge dann anders liegen, wenn der Arzt mit der Lebenssituation des Suizidwilligen näher vertraut ist. In einem der beiden Fälle Fall handelte es sich allerdings nicht um den Hausarzt, sondern um einen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, der die Begutachtung der Freiverantwortlichkeit und Sterbebegleitung übernommen hatte. Dieser war nicht rettungspflichtig [BGHSt 64, 121]. Es besteht aber auch für den Hausarzt jedenfalls dann keine Rettungspflicht, wenn eine eindeutige Abrede darüber getroffen wurde, dass nur noch eine Sterbebegleitung gewünscht wird und das Arzt-Patienten-Verhältnis im Übrigen nicht mehr fortbestehen soll [BGHSt 64, 135, s. das Fallbeispiel]. Leider bleibt damit offen, wie bei Fehlen einer derartigen Abrede zu entscheiden ist [Rissing-van Saan u. Verrel 2020].
Fallbeispiel
Die 44-jährige Patientin litt seit ihrer Jugend an einem nicht lebensbedrohlichen, aber starke Schmerzen verursachenden Reizdarmsyndrom, rezidivierenden Harnwegsinfektionen und Analfisteln. Da ihr das Leben nicht mehr als lebenswert erschien, wandte sie sich an ihren Hausarzt mit der Bitte, sie bei ihrer Selbsttötung zu unterstützen. Der Hausarzt verschrieb und überließ seiner Patientin tödlich wirkende Medikamente, die sie einnahm. Verabredungsgemäß suchte der Hausarzt, der dazu einen Hausschlüssel erhalten hatte, seine Patientin nach der Einnahme mehrfach auf und traf sie jeweils in einem tief komatösen Zustand an, ohne Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Ob sie von ihm zu diesem Zeitpunkt noch hätte gerettet werden können, konnte nicht geklärt werden. Der Bundesgerichtshof hat den angeklagten Hausarzt freigesprochen. Eine versuchte Tötung durch Unterlassen verneinte er, weil der Hausarzt durch die Abrede über die Sterbebegleitung nicht mehr Garant für das Leben seiner Patientin gewesen sei. Einer Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung stünde entgegen, dass eine Hilfeleistung gegen den geäußerten Willen der Suizidentin für den Hausarzt nicht zumutbar gewesen sei [BGHSt 64, 135].
Die zweite Konstellation, der Umgang des Arztes mit der Bitte von Patienten, Suizidassistenz z. B. durch Bereitstellung von dazu geeigneten Substanzen zu leisten, birgt trotz des vom BVerfG für verfassungswidrig erklärten § 217 StGB und der vom Gericht betonten grundrechtlichen Absicherung freier Suizidentscheidungen nach wie vor strafrechtliche Risiken. Zwar hat das BVerfG klargestellt, dass „die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, (...) auch die Freiheit (umfasst), hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen“ und auch, dass diese Freiheit nicht nur in Ansehung schwerer oder unheilbarer Krankheit besteht [BverfGE 153, 182, 262 f.]. Straflose Suizidhilfe setzt jedoch wiederum einen freien Suizidentschluss voraus, denn zu respektieren ist nur der Selbsttötungswunsch der „Ausdruck der zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen Person“ ist. Wer einem nicht freiverantwortlich handelnden Patienten Suizidhilfe leistet, kann sich wegen eines fahrlässigen oder vorsätzlichen Tötungsdelikts strafbar machen. Ob dagegen die auch schon bisher mögliche Strafbarkeit des Arztes wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz [vgl. BGHSt 46, 279] einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten würde, darf nach den Ausführungen des BVerfG bezweifelt werden.
Während das BtMG bisher nicht reformiert wurde, hat der 124. Deutsche Ärztetag auf die vom BVerfG angemahnte „konsistente Ausgestaltung des Berufsrechts der Ärzte und Apotheker“ (Rn. 341) reagiert, und das 2011 in § 16 Satz 3 der Musterberufsordnung (MBO) aufgenommene Verbot ärztlicher Suizidhilfe aufgehoben (www.ärzteblatt.de/2021Top4). Es ist nunmehr Aufgabe derjenigen 10 Landesärztekammern, die seinerzeit ein Suizidhilfeverbot in ihre Berufsordnungen aufgenommen hatten, dieses ebenfalls zu streichen. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber das Spannungsverhältnis auflöst, das zwischen der ihm vom BVerfG eingeräumten Befugnis zu einem „legislatorisches Schutzkonzept“ und der gleichzeitig betonten Grenze besteht, dass dem Recht auf assistierte Selbsttötung „auch faktisch hinreichenden Raum zur Entfaltung und Umsetzung“ belassen werden muss [BVerfGE 153, 182, 309].
Die Mitwirkung eines Arztes an einem Patientensuizid ist nur bei eindeutiger Freiverantwortlichkeit straflos. Eine in Folge der Entscheidung BVerfGE 153, 182 zu erwartende gesetzliche Regelung der ärztlichen Suizidassistenz könnte weitere, u. U. strafrechtlich abgesicherte Einschränkungen (z. B. Fristen, Beratungen, Begutachtungen) vorsehen.
Als Suizid können auf den ersten Blick auch die Fälle erscheinen, in denen sich Zeugen Jehovas einer Bluttransfusion selbst bei elektiven Eingriffen verweigern. Bestehen keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung, deren Konsequenzen der Arzt dem Patienten freilich in aller Deutlichkeit vor Augen führen muss, handelt es sich um eine zu respektierende, mit § 1901 a Abs. 3 BGB im Einklang stehende Ausprägung der Patientenautonomie, also des Rechts, auch vital indizierte Behandlungen zu verweigern. Der Arzt kann eigenen Gewissenskonflikten dadurch aus dem Wege gehen, dass er die von ihm zu verantwortende Behandlung nur unter der Bedingung übernimmt, erforderlichenfalls auch eine Blutübertragung durchführen zu dürfen. In Notfällen kommt es auf die Ernsthaftigkeit der Verweigerung an und wird der Arzt wegen der dann zumeist bestehenden Beurteilungsunsicherheit im Zweifel lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen dürfen [vgl. BVerfG, NJW 2002, 206 f.; Ulsenheimer 2005]. Verweigern Eltern für ihre Kinder, die in aller Regel selbst keinen wirksamen Verzicht auf eine lebenserhaltende Behandlung aussprechen können, die Einwilligung in eine indizierte Bluttransfusion, stellt dies einen Missbrauch des elterlichen Sorgerechts dar [Bender 1999]. Der Arzt informiert dann das Familiengericht, das den Eltern partiell das Sorgerecht entziehen und einen Pfleger für das Kind bestellen oder in dringenden Fällen selbst die Einwilligung erteilen kann [vgl. OLG Celle, NJW 1995, 792]. Besteht sofortiger Handlungsbedarf, können lebenserhaltende Maßnahmen unter Berufung auf die Grundsätze der mutmaßlichen Einwilligung ergriffen werden.