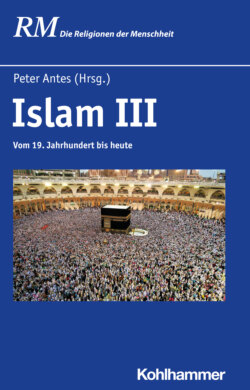Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Der historische Kontext
ОглавлениеLebten die Muslime in den meisten Teilen Afrikas bis zum späten 19. Jahrhundert noch weitgehend in autonomen lokalen Gemeinschaften, oft unter der Autorität eines Imams, eines Emirs oder eines Sultans, so fanden sie sich im frühen 20. Jahrhundert in neuen politischen Kontexten wieder, in denen die hegemoniale Macht an neue, nicht-muslimische Herren übergegangen war. Im Kontext der kolonialen Aufteilung Afrikas wurden aber nicht nur zahllose neue Grenzlinien geschaffen, die nur zum Teil historischen Grenzzonen entsprachen, sondern es wurden auch Gebiete zusammengeschlossen, die bis zu diesem Zeitpunkt kein besonders ausgeprägtes gemeinsames historisches Erbe aufzuweisen hatten. Kamen so die Gebiete an der Guineaküste seit dem 16. Jahrhundert immer stärker in den Einzugsbereich europäischer Handelsmächte und des transatlantischen Sklavenhandels, so entwickelten die »sudanischen« Regionen des westafrikanischen Binnenlandes (arab.: bilād as-sūdān, »die Länder der Schwarzen«) im Rahmen der Herausbildung islamischer Emirate im Gefolge der Dschihad-Bewegungen in dieser Region seit dem 18. Jahrhundert (s. unten) ein vollkommen anderes historisches Erbe.
Während die Dschihad-Bewegungen die bilād as-sūdān grundlegend verwandelt haben, blieben die Gesellschaften des tropischen Waldgürtels an der Guineaküste von diesen strukturellen Veränderungen weitgehend unberührt. Im Kontext der Entstehung französischer, britischer und deutscher Kolonien in Westafrika im späten 19. Jahrhundert wurden die mehrheitlich nicht-muslimischen Gesellschaften der tropischen Waldregionen aber mit muslimischen Mehrheitsgesellschaften des Sudangürtels in neuen kolonialen Territorien wie Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire), Gold Coast (Ghana), Togo, Dahomey (Benin), Nigeria oder Kamerun zusammengeschlossen. Konflikte in diesen Territorien konnten leicht in religiösen Kategorien ausgedrückt werden und wurden als historisches Erbe in die koloniale und postkoloniale Geschichte dieser Länder eingeschrieben.
Die langfristigen Folgen kolonialer Grenzziehungen lassen sich aber nicht nur für das heutige Westafrika feststellen, sondern auch für andere Gebiete Afrikas, so etwa für den Nilsudan (die Republik Sudan) oder die ostafrikanischen Länder (Kenia, Tansania und Uganda), in denen ebenfalls Bevölkerungen mit ganz unterschiedlichen historischen Traditionen in neuen kolonialen und postkolonialen Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen wurden. In der Kolonialzeit entstand so eine Reihe von Konfliktfeldern, die von Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen geprägt waren und die bis heute Entwicklungsprozesse beeinflussen. Jedoch entwickelte sich die Religion (der Islam) nur in einigen Ländern zu einer Differenzkategorie, die aktiviert wurde, um partikulare Identitäten zu betonen, um die Abgrenzung zu Christen oder zum säkularen Staat zu verschärfen und um angesichts bestehender innerreligiöser Streitigkeiten eine übergreifende Solidarität der Muslime einzufordern. Ganz allgemein lassen sich im gegenwärtigen Afrika drei Gruppen von Ländern mit muslimischen Bevölkerungsgruppen unterscheiden:
1. Länder wie Senegal (Mali, Niger, Somalia, Gambia), in denen die Muslime eine klare und unangefochtene Mehrheit der Bevölkerung stellen. Die Religion (der Islam) ist ein akzeptierter Teil des alltäglichen Lebens aller Menschen, auch der Nicht-Muslime. Es gibt keine nennenswerten religiösen Konflikte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, obwohl es Klagen von Seiten der Nicht-Muslime hinsichtlich des Grades ihrer Integration (oder Nicht-Integration) in die nationale Gesellschaft geben kann. Existierende Konflikte sind vor allem ökonomischer, politischer, sozialer, ethnischer oder kommunaler Natur und nehmen nicht notwendigerweise religiöse Konnotationen an. Konflikte unter Muslimen sind hingegen sehr wohl mit Fragen des religiösen Rituals und Fragen der religiösen Deutungshoheit verbunden, wobei sowohl einzelne Gelehrte, wie auch unterschiedliche religiöse Gruppierungen miteinander konkurrieren.
2. Länder wie Südafrika (Namibia, Botswana, Angola, Togo), in denen die Muslime eine eindeutige Minderheit der Bevölkerung darstellen. Der »Islam« ist kein relevanter Teil des Alltagslebens der Bevölkerungsmehrheit und es gibt wiederum keine nennenswerten religiösen Konflikte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, obwohl es Klagen von Seiten der Muslime hinsichtlich des Grades ihrer Integration (oder Nicht-Integration) in die nationale Gesellschaft geben kann. Existierende Konflikte beziehen sich auf ökonomische, politische, soziale, ethnische oder kommunale Fragen und nehmen nicht notwendigerweise religiöse Konnotationen an. Konflikte unter Muslimen sind hingegen erneut mit Fragen des religiösen Rituals und Fragen der religiösen Deutungshoheit verbunden, wobei sowohl einzelne Gelehrte, wie auch unterschiedliche religiöse Gruppierungen miteinander konkurrieren.
3. Länder wie Nigeria (Äthiopien, Tansania, Kenia, Tschad, Sudan, Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso, Kamerun), in denen die Muslime (bzw. Christen) einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung stellen, vielleicht sogar die Bevölkerungsmehrheit, auf jeden Fall aber die Mehrheit in einem oder in mehreren Landesteilen. Falls die Muslime (Christen) im Gesamtstaat oder in einzelnen Landesteilen eine Minderheit darstellen, sind sie so stark, dass sie die Politik und die Entwicklung eines Landes maßgeblich beeinflussen können. Konflikte in diesen Ländern haben multiple ökonomische, soziale, ethnische, politische und kommunale Dimensionen und können jederzeit religiöse Bedeutung erhalten. Die Religion (Islam, Christentum) stellt somit in diesen Ländern eine wichtige Plattform für die politische, soziale, ökonomische, kommunale und ethnische Mobilisierung der Menschen dar.