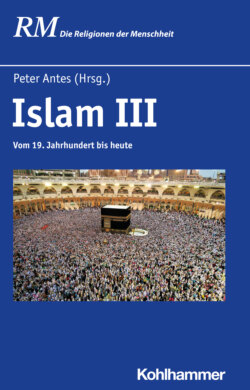Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Das Erbe der Kolonialzeit
ОглавлениеDie koloniale Eroberung des subsaharischen Afrika durch die europäischen Kolonialmächte, insbesondere Frankreich und Großbritannien, aber auch Deutschland (in Gestalt der Kolonien Togo und Kamerun, sowie Deutsch-Ostafrika) und Italien (in Gestalt der Kolonien Eritrea und Somalia), setzte der weiteren Entwicklung der aus den Dschihad-Bewegungen entstandenen islamischen Staaten ein Ende. Trotz der Gräuel der kolonialen Eroberung und Unterwerfung muslimischer Bevölkerungen präsentierten sich aber alle Kolonialmächte als »Schutzmächte der Muslime« und versuchten ihre muslimischen Untertanen als Verbündete in zwei Weltkriegen zu gewinnen. Diese Politik war zumindest teilweise erfolgreich, weil die europäischen Kolonialmächte weder in ihren kolonialen Eroberungen noch in ihrer Verwaltung auf eine einheitliche »muslimische« Antwort trafen. Die muslimischen Gemeinschaften vom Atlantik bis zum Indischen Ozean und vom Mittelmeer bis zum Sambesi waren vielmehr durch vielfältige Fragmentierungen und zahlreiche lokale Auseinandersetzungen gekennzeichnet. In der Folge war es für die Kolonialmächte häufig einfach, ihre Kolonialherrschaft unter der Devise des divide et impera zu errichten und zu betreiben und diejenigen lokalen Führer als Mittelsmänner in die Kolonialverwaltung zu integrieren, die bereit waren, mit der Kolonialverwaltung zu kooperieren.
Die Errichtung der kolonialen Herrschaft und die koloniale Verwaltung Afrikas brachte jedoch verschiedene »paths of accommodation«15 hervor, die in der postkolonialen Gegenwart fortbestehen: vom Dschihad zum Rückzug und zur Verstellung (taqīya) oder Emigration (Hidschra) bis hin zur partiellen Kooperation, zur vollständigen Unterwerfung und Kollaboration und Allianz, eine politische Option, die in islamischen theologischen Begriffen als muwālāt, »Freundschaftsbeziehung« legitimiert wurde. Diese »paths of accommodation« waren niemals statisch, sondern veränderten sich in der Kolonialzeit und der Postkolonialzeit ständig: einige religiöse Gelehrte waren willens, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, während andere versuchten, sich der Vereinnahmung durch den Staat zu entziehen und sich in politische Abstinenz und Neutralität oder Isolation zurückzuziehen. Die politische Rolle muslimischer religiöser Bewegungen war dabei immer kontextabhängig, unterlag daher situationsgebundenen Aushandlungsprozessen und rangierte in einem breiten Spektrum von Positionen, die beschrieben werden können als »an der Macht sein« über »nahe an der Macht sein«, zu Akzeptanz der fremden Herrschaft und Zusammenarbeit mit dem Staat, bis hin zu Rückzug, Quietismus und letztendlich, wenn auch selten, Widerstand und aktiven Kampf gegen den kolonialen und postkolonialen Staat – beispielsweise in Nordnigeria im Fall der Maitatsine-Bewegung 1981–1986 und der Boko Haram-Bewegung nach 2004.16
Das Erbe der Kolonialzeit, das die Muslime in den unterschiedlichen Ländern Afrikas bis heute beschäftigt, ist ein zentrales Thema für die Analyse der politischen Entwicklung Afrikas seit den Unabhängigkeiten der 1960er Jahre. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass Konfliktursachen vielfältig sind und dass Begründungen, Form und Verlauf von Konflikten veränderlich sind. Der Fokus auf die Bedeutung des kolonialen Erbes für die Muslime in Afrika verdeutlicht, dass die Unabhängigkeiten der 1960er Jahre keineswegs zum Bruch mit kolonialen Entwicklungstraditionen geführt haben. Erst seit den späten 1970er und frühen 1980er Jahren kam es in vielen afrikanischen Staaten mit muslimischen Bevölkerungsgruppen zur Entwicklung neuerer Salafi-orientierter muslimischer Reformbewegungen (s. unten), die damit begannen, koloniale und postkoloniale Entwicklungstraditionen in Frage zu stellen. Aber anders als Samuel Huntington behauptet, war und ist »der Islam« in Afrika keineswegs die wichtigste oder gar die einzige treibende Kraft in postkolonialen Konflikten. Am Ende der Kolonialzeit hatten sich in vielen Kolonialgebieten vielmehr neue muslimische Eliten gebildet, die sich nun anschickten, entweder selbst die Macht in den neuen Staaten Afrikas zu übernehmen, oder sie mit anderen Gruppen zu teilen. Dennoch verlangte kein einziger muslimischer Politiker nach der Unabhängigkeit die Einführung eines »islamischen Staates«. Politiker unterschiedlicher religiöser Denominationen (Mamadou Dia, Leopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Yomo Kenyatta, Modibo Keita, Sekou Touré u. a.) vertraten vielmehr verschiedene Modelle eines »afrikanischen Sozialismus«. Es stellte sich jedoch die Frage, ob die neuen politischen Führer Afrikas nach der Unabhängigkeit in der Lage sein würden, die Versprechungen einer besseren Zukunft für eine Mehrheit ihrer Bevölkerungen und Nationen zu erfüllen und moderne Institutionen zu entwickeln, die dazu beitragen würden, aus unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen und Religionen eine Nation zu formen und das koloniale Erbe der Teilung und Neuordnung Afrikas zu überwinden. Zudem stellte sich die Frage, wie die Muslime angesichts ihres historischen Erbes mit ihrer Rolle als Minderheit oder Mehrheit im postkolonialen Staat umgehen würden.
In vielen afrikanischen Ländern ist es den politischen Eliten in der Nachkolonialzeit nicht gelungen, grundlegende strukturelle Entwicklungsprobleme zu lösen, die ihrerseits in vorkolonialen historischen Erfahrungen und in den in der Kolonialzeit etablierten Strukturen der Macht- und Ressourcenverteilung begründet sind. Damit blieb einem breiten Spektrum der Bevölkerung der Zugang zu Ressourcen und politischen Führungspositionen versperrt. Diese Verteilungsungerechtigkeit verschärfte strukturelle Entwicklungsungleichgewichte, die bis heute einen zentralen Motivationshintergrund für Konflikt darstellen.
Angesichts der Unfähigkeit vieler post-kolonialer Regierungen, das Erbe der Kolonialzeit zu überwinden und einer breiten Bevölkerung Zugang zu Mitsprache und Ressourcen zu gewähren, konnte sich der Islam in einigen afrikanischen Ländern zumindest zeitweise zu einer zentralen Differenzkategorie und zu einem Mobilisierungsfaktor entwickeln. Es ist jedoch auffallend, dass bis heute in keinem einzigen afrikanischen Staat mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit ein islamisches Imamat proklamiert wurde oder der Islam zur alleinigen Legitimationsgrundlage des Staates erhoben wurde, obwohl dies im Falle des Sudan nach 1989 und Somalias nach 1991 zeitweilig möglich erschien. Dies zeigt, dass die aus der Kolonialzeit ererbten europäischen Staatskonstruktionen von erstaunlicher Resilienz waren und die Religion bislang vorrangig ein Mittel der politischen Mobilisierung und nicht Grundlage für eine Umgestaltung von Gesellschaft und Staat war.