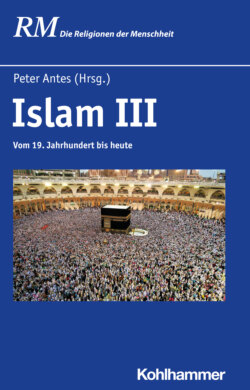Читать книгу Islam III - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Die Bedeutung des lokalen Kontexts für religiöse Konflikte
ОглавлениеBesonders deutlich treten religiös konnotierte Konflikte in denjenigen Kontexten hervor, in denen der Islam eine zentrale gesellschaftliche und politische Rolle zu spielen scheint, etwa in Senegal, in der Elfenbeinküste, in Nigeria oder in der Republik Sudan: In Senegal entwickelte sich seit den frühen 1980er Jahren in der südlichsten Landesregion, der Basse Casamance (Region Ziguinchor), eine lokale Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegung, die sich gegen muslimische Zuwanderer und die Vormachtstellung (muslimischer) Verwaltungskader aus dem Norden des Landes wandte und die in den Medien als eine Rebellion der nicht-muslimischen und teilweise christlichen Bevölkerung der Basse Casamance gegen die Vormacht des muslimischen Nordens beschrieben wurde.17 In der Elfenbeinküste hatten sich die Muslime in der Kolonialzeit zur stärksten religiösen Gruppe des Landes entwickelt, dennoch wurde die muslimische Bevölkerung der Elfenbeinküste unter der Herrschaft der Präsidenten Houphouët-Boigny (reg. 1960–1993), Bédié (reg. 1993–1999) und Gbago (reg. 2000–2010) zunehmend marginalisiert und aus dem politischen Leben des Landes ausgegrenzt. Diese Entwicklung zeigte sich im Ausschluss des aus dem Norden des Landes stammenden Politikers Alassane Ouattara von den nationalen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen der 1990er Jahre. Der Ausschluss Ouattaras erfolgte über eine entsprechende Veränderung der Verfassung, wodurch vorgeschrieben wurde, dass beide Elternteile eines Präsidentschaftskandidaten aus der Elfenbeinküste zu stammen hatten – der Vater von Alassane Ouattara stammte zwar aus Kong in der Elfenbeinküste, seine Mutter kam jedoch aus Burkina Faso, dem kolonialen Haute Volta (Obervolta).18
In Nigeria nutzten die nicht-muslimischen Bevölkerungen des »Middle Belt« – die zentralen Landesteile zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem mehrheitlich christlichen Süden19 – die Freiheit des postkolonialen Nationalstaats, um sich aus der Bevormundung durch die muslimische Aristokratie des Nordens zu lösen. Seit den 1980er Jahren kam es dort zu einer Reihe blutiger Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen, die durch die aggressive Missionstätigkeit charismatischer Kirchen verschärft wurden. Als es einem charismatischen Christen aus dem Süden, Obasanjo, im Jahre 1998 gelang, in freien Präsidentschaftswahlen die Mehrheit der Stimmen im Land zu erringen, wurde dies von den muslimischen Eliten im Norden als Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen gesehen, dass nämlich nunmehr das alte dār al-Islām im Norden unter die Vorherrschaft der christlichen Eliten aus dem Süden und der »Middle Belt«-Region kommen würde.
Im Sudan wehrten sich die weitgehend nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen des Südens seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1956 gegen die Gleichschaltung mit dem weitgehend muslimischen Norden und führten in der Folge einen fast 50-jährigen Befreiungskrieg, der 2011 mit der Unabhängigkeit des Südsudan endete – und bald darauf in einen blutigen Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Milizen der Dinka und der Nuer überging.
Die Regierungen des Senegal, der Elfenbeinküste, Nigerias und des Sudan scheiterten so letztlich an der Aufgabe, nach der Unabhängigkeit eine überzeugende nationale Integrationspolitik zu betreiben. In der Folge kam es in diesen Ländern zu den geschilderten Konfliktkonstellationen, die sich auf Grund ihrer vorkolonialen Wurzeln als religiöse Konflikte zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen präsentieren lassen.
Diese Konflikte scheinen die These Huntingtons von den »blutigen Grenzen« des Islam (»Islam’s bloody borders«)20 zu bestätigen. In der Tat bestätigen die hier genannten Konflikte scheinbar die Existenz einer historischen Bruchlinie zwischen dem »Islam« und nicht-muslimischen Territorien, die durch die Dschihad-Bewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts begründet worden war: Der Senegal (nördlich des Gambia) kann so auf eine lange Tradition der Islamisierung seit dem 11. Jahrhundert verweisen, während die Region der Basse Casamance erst seit den 1870er Jahren in den Einflussbereich eines muslimischen Emirates, Fuladu, kam.21 Erst in der Kolonialzeit wurde die nicht-muslimische Bevölkerung der Basse Casamance zu einer Minderheit in der von Muslimen dominierten Kolonie Senegal.
Auch die nördliche Elfenbeinküste kann auf eine lange Geschichte islamischer Lehrzentren verweisen, die mit der ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Suware-Tradition verbunden waren. Ende des 19. Jahrhunderts wurden weite Gebiete des Nordwestens zudem Teil eines von Samori Touré begründeten Staates, in dem der Islam eine wichtige einigende Rolle spielte und Samori Touré als Förderer der Muslime auftrat, obwohl er selbst seine Kriege niemals als Dschihad legitimierte. In der Kolonialzeit verloren die muslimischen Bevölkerungsgruppen des mittleren Voltagebiets aber ihre regionale Vormachtstellung an neue christliche Eliten aus dem Süden der Kolonie, die auf Grund ihrer besseren Ausbildung rasch die Führung im Wirtschaftsleben, in der Politik und in der Verwaltung übernahmen.22
In Nordnigeria wurde im Gefolge eines von Usman dan Fodio geführten Dschihads nach 1804 das bereits genannte Sokoto-Kalifat begründet, das sich im 19. Jahrhundert zum größten islamischen Flächenstaat des westlichen Afrika überhaupt entwickelte. Dabei expandierte das Sokoto-Kalifat auch in seine südlichen Grenzregionen, die vor allem der Sklavenjagd dienten. Diese »slave hunting fringes« – die »Middle Belt«-Gebiete des heutigen Nigeria – wurden als »a boundary of terror and hostility« beschrieben.23 Die islamischen Emirate des Nordens und das Sokoto-Kalifat schufen so im 19. Jahrhundert ein historisches Erbe, das bis heute die islamische Identität der muslimischen Bevölkerungsgruppen Nordnigerias entscheidend prägt und das als eine ideale Zeit erinnert wird, in der die Muslime die Macht hatten. Die heutigen Bevölkerungen der »slave hunting peripheries«, die in der Kolonialzeit überwiegend Christen geworden sind und heute häufig charismatischen Pfingstkirchen folgen, erinnern sich jedoch ganz anders an die Zeit der Emirate und bestreiten den Muslimen nationale Vormachtansprüche. Die Emanzipationsbemühungen der christlichen Bevölkerungsgruppen des »Middle Belt« begründeten wiederum Konflikte mit den etablierten muslimischen Eliten des Nordens, die sich nach der Unabhängigkeit immer wieder in blutigen Auseinandersetzungen entluden.24
Im Sudan brach 1885 die 1820/1821 begründete ägyptische Kolonialherrschaft zusammen und wurde von einem islamisch legitimierten Staat abgelöst, der in der Literatur meist als das »Reich des Mahdi« bezeichnet wird und der sich wie die ägyptische Herrschaft durch eine aktive Expansionspolitik in den nicht-muslimischen Süden auszeichnete.25 Aber auch nach der Zerschlagung des »Reiches des Mahdi« 1898 durch die Briten wurden die nicht-muslimischen Bevölkerungsgruppen der Länder am oberen Nil von muslimischen Verwaltungskadern aus dem Norden majorisiert, eine Herrschaftstradition, die sich auch nach der Unabhängigkeit des Landes 1956 fortsetzte und letztendlich in den bereits genannten Sezessions- und Bürgerkrieg mündete.
An dieser Stelle muss jedoch eine argumentative Umkehr erfolgen, die zeigt, dass Huntingtons dictum der »blutigen Grenzen des Islam« kein weiterführendes Argument darstellt: Konflikte müssen vielmehr als Prozesse gesehen werden, deren Bedingungen und Motivationen sich ständig verändern. Zum einen haben die genannten »religiösen« Konflikte zahlreiche weitere Konnotationen, die es zulassen, diese Konflikte auch als ethnische, ökonomische und politische Konflikte zu interpretieren, selbst wenn der Religion eine Rolle als Mobilisierungsfaktor zukommt. In der Tat wäre es sinnvoller, in allen vier Ländern von einem Cocktail an Konfliktursachen zu sprechen, in welchem sich die Gewichtung der einzelnen Bestandteile konjunkturell immer wieder verändert hat und scheinbar klare Zuschreibungen von heute schon morgen nicht mehr gelten. Konflikte konnten zudem im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Eigenschaften annehmen und durch eine Reihe von Entwicklungsstadien gehen, die es letztendlich unmöglich machen, von ausschließlich religiösen Konflikten zu sprechen:
Die Auseinandersetzungen in der Basse Casamance beispielsweise begannen in den frühen 1980er Jahren als Protest gegen die gewaltsame Unterbrechung einer Diola-Initiationszeremonie in einem heiligen Hain durch senegalesische Sicherheitskräfte. Dieser zunächst begrenzte Disput vor dem Hintergrund lokaler religiöser Traditionen veränderte seither vielfach seinen Charakter und geriet zeitweise, phasenweise sogar gleichzeitig, zu einem Kampf für die politische Autonomie der Basse Casamance, zu einem Kampf für die Bürgerrechte der Diola der Region, zu einem Bandenkrieg zwischen verschiedenen (auch muslimischen) Kriegsherren, zu einem Kampf um die Kontrolle des Drogenhandels an der Grenze zu Guinea-Bissau und die Kontrolle der Bodenschätze (Erdöl) in der Region.26 Die Zusammensetzung des Konflikt-Cocktails und auch die Gruppe der Akteure veränderten sich somit in den letzten dreißig Jahren ständig.
Auch das Beispiel der Elfenbeinküste zeigt, dass die Religion nicht immer und nicht automatisch zu einer entscheidenden Differenzkategorie in einem Konflikt geraten muss: In der Elfenbeinküste ergab sich im Kontext des Bürgerkrieges von 2002/2003 eine faktische Teilung des Landes in einen muslimischen Norden und einen christlichen Süden. Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahre 2002 erwies sich jedoch rasch, dass die Religion kein entscheidender Mobilisierungsfaktor im Bürgerkrieg sein würde: So war der Führer der muslimischen Rebellen des Nordens, Guillaume Soro, ein ehemaliger Seminarist, und im Kontext des Bürgerkriegs in der Elfenbeinküste kam es zudem bald zur Fragmentierung der unterschiedlichen Konfliktparteien im Norden wie im Süden des Landes.27 Dazu gab es beträchtliche muslimische Bevölkerungsgruppen im Süden des Landes, die in der Berichterstattung über den Konflikt meist unterschlagen wurden, die aber ebenso wie die muslimischen Gruppen des Nordens eine religiöse Interpretation der Auseinandersetzung ablehnten.28 Selbst die Zerstörung einiger Moscheen in der Region Abidjan und der damit verbundene Versuch einer Polarisierung der Lager wurde von den Muslimen als eine politische Strategie erkannt und verurteilt und verfehlte ihr Ziel.29 Der Sieg des »Muslim« Alassane Ouattara bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 2010 und die Entmachtung des »Christen« Laurent Gbagbo im April 2011 war ein weiterer Beleg für die Schwäche des Mobilisierungsfaktors Religion.
Im Falle der Konflikte in Nordnigeria und insbesondere im »Middle Belt« erweist sich ebenfalls bei näherem Hinsehen, dass häufig nicht die Religion, sondern Streitigkeiten um Land- und Weiderechte oder Spannungen zwischen ethnischen Gruppen einen unmittelbaren Hintergrund für Auseinandersetzungen darstellten: Was sich auf einer lokalen Ebene als ein Konflikt um Weiderechte oder um das Recht um den Zugang zu Ressourcen wie Wasser und Land abbildete, konnte sich auf einer regionalen Ebene als Teil eines historisch angelegten ethnischen Konflikts zwischen alteingesessenen Bauernbevölkerungen, beispielsweise zwischen den Birom-Bauern des Jos-Plateaus und zuwandernden FulBe-Viehhirten, darstellen. Auf einer nationalen Interpretationsebene konnten diese Auseinandersetzungen schließlich zu einem religiösen Konflikt zwischen Muslimen und Christen eskalieren.30 Weil diese Auseinandersetzungen in komplexen lokalen Strukturen begründet waren, die als solche genuin und damit nicht mit anderen Ländern und Konfliktfeldern vergleichbar waren, wurden sie von interessierten Parteien und vielen Medien auf nationaler oder internationaler Ebene häufig vereinfacht als religiöse oder politische Konflikte präsentiert.
Ähnliches gilt für den Sudan, wo christliche und andere nicht-muslimische Gruppen aus partikularistischen Gründen immer wieder bereit waren, sich mit den Truppen der Zentralregierung gegen die jeweils dominierende regionale Autonomiebewegung zu verbünden. Der Unabhängigkeitskrieg des Südsudan seit seinen Anfängen in den 1950er Jahren hatte daher immer den Charakter eines Bürgerkriegs der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen des Südens, insbesondere der Dinka und der Nuer,31 auch dies eine Tradition, die nach der Unabhängigkeit des Südsudan 2011 fortgeführt wurde.
Die Beispiele der Basse Casamance, der Elfenbeinküste, des »Middle Belt« in Nigeria, aber auch des Sudan zeigen, dass sich die Analyse eines Konfliktes und die Berichterstattung über eine Auseinandersetzung vor allem an der Frage orientieren sollten, wie sich die Rahmenbedingungen eines Konflikts und die Motivationen der Akteure in einem Konfliktfeld im Lauf der Zeit verändert haben und was die spezifischen Beweggründe für Veränderungen in einem Konfliktcocktail waren.
Schließlich haben nicht alle Konflikte, an denen Muslime als Akteure beteiligt sind, religiöse Konnotationen: Im Darfur-Konflikt der 2000er Jahre etwa führten die Rebellen der (muslimischen) Autonomiebewegung ihre Autonomie-Forderungen gegenüber der Zentralregierung in Khartoum auf die historische Eigenständigkeit des Sultanats von Darfur zurück;32 die Rebellionen der Tuareg in Niger und Mali in den 1980er und 1990er Jahren richteten sich gegen Regierungen, die ihrerseits eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung vertraten; die anhaltenden Spannungen in Mauretanien sind Ausdruck der historischen Marginalisierung der sesshaften afrikanischen (»schwarzen«, muslimischen) Bevölkerungen des Südens durch die (»weiße«, arabische) politische Elite des Nordens.
Zudem gibt es eine Reihe von Staaten, die ebenso wie Senegal, die Elfenbeinküste, Nigeria und der Sudan auf historischen Bruchlinien liegen, die es aber verstanden haben, die in der Kolonialzeit angelegten Ungleichgewichte zu überwinden, eine weitgehend erfolgreiche nationale Integrationspolitik zu betreiben und für eine gerechtere nationale Macht- und Ressourcenverteilung zu sorgen: In Westafrika stellen Ghana, Burkina Faso und – mit Einschränkungen – Kamerun33 erfolgreiche Modelle für nationale Integration dar: Obwohl sich die muslimischen Bevölkerungen dieser Länder mit muslimischen vorkolonialen staatlichen Traditionen identifizieren können, sind sie heute weitgehend in die nationale Politik ihrer Länder integriert, die Religion stellt weder in Ghana, noch in Burkina Faso noch in Kamerun ein primäres Identifikationsmodell dar. Ähnliches gilt für die ostafrikanischen Länder Kenia und Tansania und selbst für die Republik Senegal nördlich des Gambia.34
Umgekehrt zeigt der Zerfall Somalias und der Bürgerkrieg in diesem Land seit 1991, der in der autoritären Politik des Diktators Siad Barre (reg. 1969–1991) begründet war, dass selbst in ethnischer wie religiöser Hinsicht außerordentlich homogene Staaten wie Somalia35 nicht à priori stabiler waren als ethnisch heterogene Länder wie Tansania, und zwar insbesondere dann, wenn der Rekurs auf die Religion als identity marker von den Konfliktparteien bewusst getroffen wurde: Aus einer theologischen Argumentation ließ sich die Legitimität des eigenen Handelns und die Illegitimität des Handels der »Anderen« immer wieder gut ableiten. In Somalia nutzte nach 2005 insbesondere die Ittiḥād al-Maḥākim al-islāmīya (»Vereinigung der islamischen Gerichte«), die bald in mehrere rivalisierende Fraktionen zerfiel, zu denen auch die Šabāb (»Jugend«)-Milizen gehörten, die Religion als Legitimierungsgrundlage ihres eigenen Handelns und zur Delegitimierung der somalischen warlords, die sich unfähig erwiesen hatten, den Bürgerkrieg in Somalia zu beenden.
Dies zeigt, dass sich Religion zwar in bestimmten historischen Gemengelagen für die Austragung und das politische Management von Konflikten instrumentalisieren lässt, und in bestimmten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konstellationen auch ein wichtiger Mobilisierungsfaktor ist, dass diesem Rekurs auf die Religion in Konflikten aber keine Automatik zu Grunde liegt. Vielmehr muss in jedem einzelnen Konfliktfall untersucht werden, wie sich der entsprechende lokale Konflikt-Cocktail zusammensetzt. Der fragmentierte Charakter muslimischer Gesellschaften Afrikas und ihre zahlreichen inneren Konflikte verhindern zudem die Entwicklung einer überzeugenden »islamischen Alternative« für eine neue politische und gesellschaftliche Ordnung und zwar auch auf Grund der Tatsache, dass die muslimischen Gesellschaften Afrikas im Bereich der Rechtsentwicklung, der sozialen Beziehungen, der Generationendynamik, des Erziehungswesens und selbst der religiösen Praxis ganz unterschiedlichen und zum Teil widerstreitenden Modellen folgen. Die Muslime des subsaharischen Afrika können daher zwar in bestimmten Konfliktkontexten als Muslime mobilisiert werden, dennoch stellt »der Islam« keine zuverlässige Grundlage für die Entwicklung tragfähiger Identitäten dar, weil es letztendlich die Gruppe »der Muslime« nicht gibt: die muslimischen Bevölkerungen des subsaharischen Afrika zeichnen sich vielmehr durch ihre außerordentlich unterschiedlichen lokalen, regionalen, nationalen und transnationalen Verankerungen und Verflechtungen und dementsprechend unterschiedliche Interessen und Solidaritäten aus.